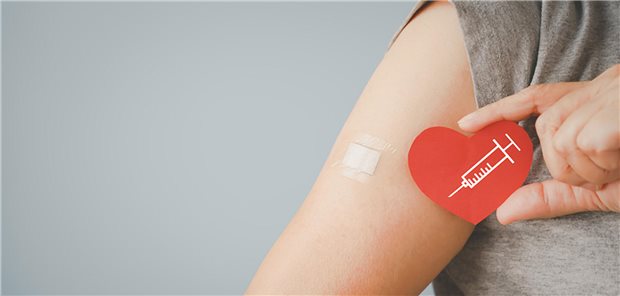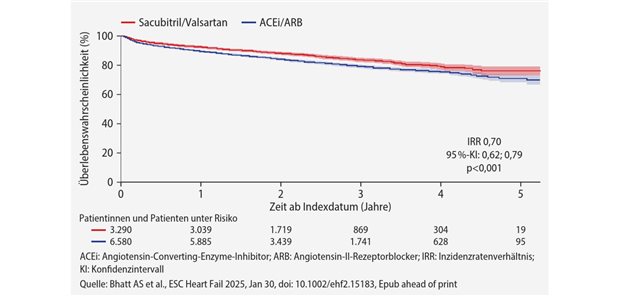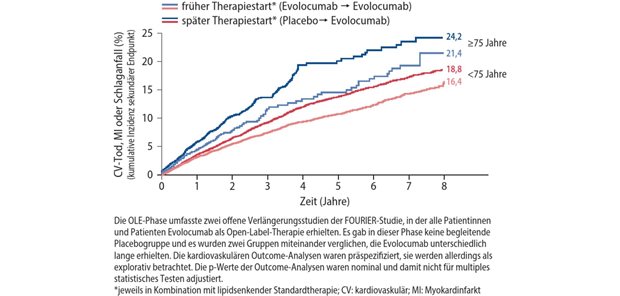EvidenzUpdate-Podcast
NVL-„Jubel“, SCOT-HEART-Kritik – und die Soundmaschine
Mit einer neuen SCOT-HEART-Publikation liegen jetzt 10-Jahres-Daten vor. Im neuen EvidenzUpdate-Podcast schauen wir, was sie für die CCTA bei V.a. KHK bedeuten. Wir reden über die Zukunft der NVL. Und jetzt neu: Scherers Soundmaschine.
Veröffentlicht:Die Koronar-CT (CCTA) zur Abklärung eines Verdachts auf chronische KHK soll ab diesem Jahr regulärer Teil der ambulanten Versorgungskette werden. Seit Dezember stehen auch die Gebührenordnungspositionen fest. Umso besser, dass jetzt die 10-Jahres-Daten der schottischen SCOT-HEART-Studie vorliegen. Die nehmen wir in dieser Episode genauer unter die Lupe und betrachten auch Kritik, die es an den Ergebnisse gab und gibt. Spoiler wenigstens einer positiven Nachricht: Entgegen anfänglicher Befürchtungen führte die vermehrte Nutzung des Herz-CT in dieser Studie auch nach zehn Jahren nicht zu einer Zunahme invasiver Koronarangiografien (PCI). Allerdings: In anderen Studien (und Ländern) gab es andere Entwicklungen.
Selbstverständlich hat auch SCOT-HEART Limitationen, die wir uns anschauen. Die erste ist das Open-Label-Design. Auch ist die untersuchte Population eine sehr besondere, weswegen die Übertragung auf die allgemeine primärärztliche Versorgung sehr begrenzt ist.
Außerdem schauen wir auf die jüngst publizierte Einigung zu den Nationalen VersorgungsLeitlinien (NVL). Die sollen nun beim Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) in Kooperation mit im IMWi der AWMF fortgeführt werden. Die erste Antwort darauf: Jubel (aus Scherers neuer Soundmaschine). Die zweite Antwort darauf: ein anderer Sound. (Dauer: 36:12 Minuten)
Anregungen? Kritik? Wünsche?
Schreiben Sie uns: evidenzupdate@springer.com
Shownotes
- 1-24 von 42 Ergebnisse oder Vorschläge für ‚soundmaschine’. Amazon.de. www.amazon.de (accessed 4 Feb2025).
- Winnat C. Ambulante Herz-CT kann ab Januar auf Kasse abgerechnet werden. ÄrzteZeitung. 2024. www.aerztezeitung.de (accessed 4 Feb2025)
- Nößler D. Nationale Versorgungsleitlinien (NVL) Werden Neu aufgestellt. ÄrzteZeitung. 2025. www.aerztezeitung.de (accessed 4 Feb2025).
- Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). S3-Leitlinie Nationale VersorgungsLeitlinie Chronische KHK. AWMF Leitlinienregister. 2024. register.awmf.org (accessed 4 Feb2025).
- Bosner S, Haasenritter J, Becker A, et al. Ruling out coronary artery disease in primary care: Development and validation of a simple prediction rule. Canadian Medical Association Journal 2010;182:1295–300. doi:10.1503/cmaj.100212
- Scherer M, Nößler D. EvidenzUpdate-Podcast: Herz-CT – Risiko überdiagnostik Oder Schutz Vor Unnötigem Herzkatheter? ÄrzteZeitung.de. 2024. www.aerztezeitung.de (accessed 4 Feb2025).
- Williams MC, Wereski R, Tuck C, et al. Coronary CT angiography-guided management of patients with stable chest pain: 10-year outcomes from the Scot-heart randomised controlled trial in Scotland. The Lancet 2025;405:329–37. doi:10.1016/s0140-6736(24)02679-5
- The SCOT-HEART Investigators. Coronary CT angiography and 5-year risk of myocardial infarction. New England Journal of Medicine 2018;379:924–33. doi:10.1056/nejmoa1805971
- The SCOT-HEART investigators. CT coronary angiography in patients with suspected angina due to coronary heart disease (scot-heart): An open-label, parallel-group, Multicentre Trial. The Lancet 2015;385:2383–91. doi:10.1016/s0140-6736(15)60291-4
- Mandrola J. When trials find implausible results-the scot-heart trial. When Trials Find Implausible Results-The SCOT-HEART trial. 2025. www.sensible-med.com (accessed 4 Feb2025).
- Foy AJ, Dhruva SS, Peterson B, et al. Coronary computed tomography angiography vs functional stress testing for patients with suspected coronary artery disease. JAMA Internal Medicine 2017;177:1623. doi:10.1001/jamainternmed.2017.4772
Transkript
Nößler: Scotch oder Irish, das ist für manche eine Glaubensfrage, nicht zu diskutieren. Wenn es aber ums Herz geht, müssen wir alle wohl zu Kilt-Fans werden. Denn heute wollen wir uns die Zehnjahresdaten der SCOT-HEART Study anschauen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des EvidenzUpdate-Podcast. Wir, das sind ...
Scherer: Martin Scherer.
Nößler: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DEGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Denis Nößler, von der Ärzte Zeitung aus dem Haus Springer Medizin. Moin, Herr Scherer!
Scherer: Moin, Herr Nößler!
Nößler: Herr Scherer, wie geht es Ihnen?
Scherer: Danke, gut soweit. Ich konnte mich unter der Grippewille bislang wegducken. Und ich habe hier eine Packung Quinoa Crispies liegen. Also was kann da noch schiefgehen?
Nößler: Okay. Quinoa ohne Grippe. Das ist das Rezept für den späten Winter, verstehe. Gut. Schauen wir mal, wie lang die Quinoa Crispies halten. Die Grippewelle hält ja noch ein bisschen. Bevor wir in die SCOT-HEART Study einsteigen, die wir uns heute vorgenommen haben, vielleicht aus aktuellem Anlass, die NVL, Herr Scherer, sind gerettet. Am Montag, den 3. Februar gab es dann das, was wir seit Monaten ahnten, dass das ZI sich darum kümmern will in Zukunft. Jubeln Sie jetzt?
Scherer: Eine Sekunde. (Jubel-Sound)
Nößler: Er jubelt.
Scherer: Ich hätte auch noch einen Alternativsound. Wie wäre es mit dem hier? (Jubel-Sound)
Nößler: Oh, ja, das klingt wie Jahrmarkt.
Scherer: Das Gerät, das hat meine Tochter von ihren Brüdern zu Weihnachten bekommen.
Nößler: Und das haben Sie jetzt einfach entwendet.
Scherer: Das habe ich entwendet und mir für diese Podcast-Aufzeichnung ausgeliehen. Es kann auch noch andere Sounds. Wie finden Sie den hier? (Sound) Oh, na ja, den können wir uns für die nächste ...
Nößler: Galt dieses Bäuerchen den NVL?
Scherer: Nein, das können wir uns aufheben für einen Studienverriss. Also nein, zurück zum Ernst. Ja, Jubel ist partiell angebracht auf jeden Fall. Wir freuen uns über diese Einigung, die Praxen atmen auf, auch die Kolleginnen und Kollegen atmen auf. Die NVL haben eine wichtige Aufgabe und auch einen exzellenten Ruf, den das ÄZQ und nicht zuletzt auch Günter Ollenschläger über Jahre hinweg etabliert und ausgebaut haben, zusammen mit allen Fachgesellschaften und auch der AWMF. Aber ...
Nößler: Aber?
Scherer: ... das Budget ist nur noch halb so groß und dafür jährliche statt fünfjährliche Aktualisierung.
Nößler: Das heißt, fünfmal mehr Arbeit für die Hälfte des Budgets.
Scherer: Das haben Sie sehr schnell ausgerechnet. Und da muss man eben sehen, wie Sie es auch gestern geschrieben haben, in Ihrem Irrgartenartikel. Ich weiß gar nicht, warum Sie da bei diesem hübschen Artikel ein grünes Irrgartenbild hatten. Das passt gar nicht so richtig zu dem Leitliniengedanken. Aber das nur beiseite. Also da steht ja schon drin in dem Artikel: Der Teufel steckt im Detail. Und so wird es dann auch sein. Also was bedeutet diese zunehmende Arbeitslast? Bedeutet die dann, dass die Fachgesellschaften mehr belastet werden? Das wäre für die DEGAM natürlich ein größeres Problem als für jede andere Fachgesellschaft, weil wir in allen NVL vertreten sind und weil alle Indikationen oder alle Themen, die Gegenstand dieser NVL sind, primär hausärztliche Beratungsansätze sind und ein Großteil dieser Versorgung eben auch in hausärztlichen Praxen stattfindet. Wenn jetzt diese erhöhte Arbeitslast dazu führen würde, dass die DEGAM da nicht mehr hinterherkommt mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit und dann dadurch auch die hausärztlich, primär ärztlich ambulante Perspektive geschwächt würde, dann wäre das ein Problem. Aber ich will nicht zu viel unken. Das müssen wir uns anschauen. Und wir werden es weiterhin sehr konstruktiv und engagiert begleiten.
Nößler: Dann kann man das ja an der Stelle auch so ein bisschen als Werbeblock verstehen für jene, die sich interessieren für Evidenz, sich vielleicht doch in Zukunft ehrenamtlich in die Leitlinienarbeit mit einzubringen.
Scherer: So ist es.
Nößler: Gut. Kurz noch eine Auflösung zu dem Irrgartenbild. Haben Sie ad hoc aus dem Stand eine Idee, wie man das Thema Nationale Versorgungsleitlinien überhaupt bebildern würde?
Scherer: Na ja, wie bebildert man Leitlinien? Also viele benutzen Bahngleise, andere benutzen so Leitplanken, die es auf Straßen gibt. Sie sind hier der Mann des illustrierten Wortes.
Nößler: So ist es.
Scherer: Aber da gibt es natürlich auch so Cartoons, da gibt es ein Cartoon, an den ich mich erinnere, zwei Arztfiguren, eine Ärztin und ein Arzt, die zwischen zwei Leitplanken gehen, die ungefähr 30 Zentimeter auseinander sind. Mit der Bildunterschrift: „Nein, Leitlinien sollen nicht einengen“. Also da kann man alles Mögliche nehmen. Man kann Schienen nehmen, man kann Gleise nehmen, man eine rote Schnur nehmen. Aber warum bitteschön einen Irrgarten?
Nößler: Aus einem ganz einfachen Grund – und da werden wir gleich zu kommen, aus dem konkreten Anlass – durch das Studiendickicht, durch das Evidenz-Dickicht. Das ist ja manchmal wie ein Irrgarten. Und ein Schritt weiter, wie oft besprechen wir hier auch Konflikte zwischen verschiedenen sogenannten Leitlinien. Konflikte zwischen Konsensus-Empfehlungen? Da hat man schon den Eindruck, dass man eigentlich dann dem Irrgarten ausgeliefert ist, aus dem eine Leitlinie helfen soll, herauszufinden.
Scherer: Da haben Sie einen wunderbaren Bogen zu unserem Evidenz-Update geschlagen. Denn das probieren wir ja genau auch mit unserem EvidenzUpdate-Podcast.
Nößler: Okay. Bogen gefunden, Ausrede gefunden zum Irrgartenbild. Und dann machen wir es konkret, gehen wir in die SCOT-HEART Study. Herr Scherer, wir hatten über die SCOT-HEART Study – es ist gar nicht so lange her – schon mal gesprochen. Erinnern Sie sich noch, wann das war, wozu das war?
Scherer: Ja, das war im Rahmen der Diskussion der Einführung des Koronar-CT bei stabiler KHK mit intermediärem Risiko in der G-BA-Methodenrichtlinie. Da hat sich die DEGAM auch schon geäußert und das haben wir besprochen. Und es gibt jetzt auch zwei Gebührenpositionen dazu, die 34370 und die 34371.
Nößler: Das kann sich keiner merken. Wo packen wir die noch mal hin zum Nachlesen?
Scherer: In die Shownotes.
Nößler: Okay. Ich schreibe mir auf, dass die GOP in die Shownotes gehen. Wir hatten – verlinken wir auch ebenfalls in den Shownotes – vor nicht ganz einem Jahr über die CCTA gesprochen. Und da kam unter anderem die SCOT-HEART Study vor. PROMISE kam auch drin vor und andere. Und jetzt liegen – das ist der Anlass unseres heutigen Gesprächs – Zehnjahresdaten aus der SCOT-HEART Study vor. Vielleicht holen Sie uns alle noch mal ab, die die Arbeit nicht so gut kennen, die Untersuchung vielleicht nicht gerade geläufig auf dem Schirm haben. Was ist das für ein Setting, was ist das für eine Studie, was untersuchen die da?
Scherer: SCOT-HEART Study, Sie haben es mit Scotch auch anmoderiert, ist eine RZT aus Schottland, der untersucht den Langzeiteffekt des Koronar-CT versus Standardversorgung bei stabiler Angina pectoris. Das Ziel war eine Verbesserung der Diagnostik, eine bessere Risikostratifizierung und eine Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse.
Nößler: Sehr gut. Wie viele Probanden haben wir da drin?
Scherer: Das waren 4.146 Patienten mit stabilen Brustschmerzen, die eben entweder der Standardversorgung oder Standardversorgung plus CCTA, also Koronar-CT zugewiesen wurden.
Nößler: Dann hoppeln wir direkt mal zu den Ergebnissen, bevor wir uns dann die Einschätzung, wie man damit umgehen muss, anschauen. Was wissen wir nach zehn Jahren?
Scherer: Wir hatten ja in den Zweijahresdaten eine relative Risikoreduktion von 41 Prozent, liegen jetzt noch bei den Zehnjahresdaten bei um die 20 Prozent relative Risikoreduktion, aber wie ich Sie kenne, Herr Nößler, lassen Sie weder die Autoren noch mich damit davonkommen und werden da wahrscheinlich noch mal einhaken. Keine signifikante Veränderung der Gesamtmortalität, aber die medikamentöse Therapie wurde besser angepasst. Das heißt im Originaltext: More preventive medications. Also damit meinen die Autoren, es wurden mehr Statine und mehr ASS verschrieben. Und kein Anstieg der invasiven Koronarangiografien, sondern ein gezielter Einsatz. Und das ist ja das, was die Kritiker immer auch befürchtet haben, dass es zu einem diagnostischen Overkill kommt. Das haben wir auch in der Vergangenheit diskutiert, dass es dann nicht heißt. Koronar-CT statt Koronarangiografie, sondern dass es ein Add-on wird. Aber das hat sich hier anders dargestellt.
Nößler: Vier Punkte. Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Scherer, die immer noch signifikante Reduktion bei nicht tödlichen Myokardinfarkten, das sind die jetzt noch gute 20 Prozent. Wir haben keine signifikante Änderung bei dem Gesamtüberleben, das bleibt. Wir sehen, dass es mehr preventive medications gibt oder beziehungsweise oreventive therapy prescript. Das heißt, da könnte man schon einen Effekt vermuten. Und jetzt habe ich fast schon wieder den vierten Punkt vergessen. Aber das entscheidende absolute ...
Scherer: Naja, kein Anstieg der invasiven Koronarangiografie.
Nößler: Danke schön! Die PCI, genau. Stichwort Überversorgung. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Absolute Risikoreduktion, Herr Scherer. In den Zehnjahresdaten, Sie haben mich quasi aufgefordert. Wir reden hier von 6,6 im CCTA versus 8,2 Prozent Ereignisrate. Macht eine absolute Risikoreduktion von 1,6. Gut oder schlecht?
Scherer: Das ist immer die Schwierigkeit, dann die klinische Relevanz solcher Zahlen zu beurteilen. Das ist erst mal gut. Aber es wird ein Gesamtpaket daraus, durch die Vermeidung anderer, zum Beispiel invasiver Maßnahmen.
Nößler: Das ist die number needed to diagnose ist hier nicht so der springende Punkt. Lassen Sie uns mal über die Limitation vielleicht der Arbeit reden. Weil da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was zu besprechen, bevor wir überlegen, was auch die Stärken sind. Also diese Untersuchung läuft seit zehn Jahren. Es gibt Zweijahresdaten, es gibt Fünfjahresdaten, jetzt eben die Zehnjahresdaten – alles in den Shownotes verlinkt. Gibt es da einen Trend? Gibt es da Unterschiede? Verändert sich da was, Herr Scherer?
Scherer: Wir hatten in den Zwei- und Fünfjahresdaten schon Hinweise auf geringere Myokardinfarktraten. Aber die Zehnjahresdaten zeigen noch mal stärker, dass sich da auch ein Benefit über den längeren Zeitraum abzeichnet und vor allem kann man da etwas besser noch zwischen den Gruppen differenzieren.
Nößler: Bevor wir gucken können, Herr Scherer, was diese Arbeit jetzt für die Situation in Deutschland – wie gesagt, es sind schottische Daten – bedeuten kann, wie man das vielleicht interpretieren kann für den klinischen Alltag, schauen wir uns mal ein bisschen die Limitation dann vielleicht auch, wenn es Stärken gibt, die Stärken an. Bei Limitationen, auch interpretatorisch am Ende, gibt es doch etliche. Also das Erste, was natürlich auffällt, es ist ein open-label trial. Vielleicht steigen wir einfach mal ein, was Ihnen durch den Kopf geht an Einschränkungen, wenn man sich mit der SCOT-HEART Study beschäftigt.
Scherer: Sie haben schon mit open label angefangen. Also man kann natürlich eine solche Untersuchung nicht verblinden. Es sei denn, es gelingt Ihnen im Stil David Copperfields ein CT verschwinden zu lassen.
Nößler: Ich könnte ein Sham-CT machen.
Scherer: Warten Sie, das war ein guter Joke. Eine Sekunde. (Sound)
Nößler: Bravissimo.
Scherer: Also das war für das Sham-CT, Herr Nößler. Also was bedeutet open label? Open label bedeutet, wir haben es alle gewusst. Die Ärztinnen, die Ärzte haben es gewusst, die Patientinnen, die Patienten haben es gewusst. Und das kann natürlich dann Implikation für die Lebensführung haben. Und dann auch die Effekte beeinflussen. Da haben Sie schon eine Limitation genannt. Eine weitere Limitation ist, dass die Patientenkohorte aus spezialisierten kardiologischen Zentren stammt, sodass dann immer die Frage ist, inwiefern die Ergebnisse dann auf der hausärztlichen Population übertragbar sind. Und wir haben es hier mit einer Population zu tun, die bereits ein erhöhtes Risiko hatte. Sie wissen, in der Allgemeinmedizin betreuen wir auch viele Betroffene, die ein niedriges bis moderates Risiko haben.
Nößler: Wo Sie es gerade sagen – das niedrige bis mittlere Risiko, das sind ja die, die von dem von Ihnen eingangs angesprochenen CCTA-Beschluss profitieren sollen.
Scherer: Genau.
Nößler: Sehen Sie noch weitere Einschränkungen, die man im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich mit SCOT-HEART beschäftigt? Oder gibt es vielleicht auch Stärken? Die wollen wir ja auch nicht untergehen lassen.
Scherer: Es ist eine robuste, methodisch saubere Studie mit einer langen Nachbeobachtungszeit, und zwar die längste Nachbeobachtungszeit in diesem Bereich, also Zehnjahresdaten bei einer solchen Population, über 4.000, das ist schon mal was. Und deshalb zeigt sie nicht nur kurzfristige Effekte, sondern bestätigt eigentlich über zehn Jahre hinweg, dass das Koronar-CT eine fundierte Rolle in der Diagnostik der stabilen KHK spielen kann. Und dabei ist eine Sache, Herr Nößler, besonders wichtig, dass die CCTA oder das Koronar-CT eben nicht zu einer Exkursion invasiver Eingriffe geführt hat, sondern zu einer gezielteren Therapie. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und so wollen wir es eigentlich auch haben. Und letztlich ist die Reduktion von Infarkten eine schon klinisch robuste Endpunktverbesserung, die man jetzt nicht komplett ignorieren kann.
Nößler: Das hat ja auch seinerzeit Josef Hecken – als das G-BA zum Beschluss anstand, da gab es viele völlig wertfreie Gespräche im Vorfeld, bevor es überhaupt den Beschluss gab – verwiesen auf Erfahrungen aus anderen Ländern. Ich meine, wir hätten bei uns in dem Gespräch vor einem guten Jahr das Beispiel Dänemark, wo die PCI wirklich noch mal hochgegangen ist dadurch. Teilen Sie die Sorge, dass das in Deutschland passieren könnte? Sie haben gesagt, es gibt zwei GOP dazu. Und die zweite GOP ist diese interdisziplinäre Fallkonferenz mit Kardiologie und Radiologie zusammen. Haben Sie diese Bedenken, dass es in Deutschland passieren könnte?
Scherer: Es ist beides möglich. Das Beispiel Dänemark hat gezeigt, dass die invasiven Eingriffe mehr wurden. Es gibt auch ein Gegenbeispiel: in England sind die Zahlen runtergegangen. Muss man einfach hoffen, dass in Deutschland sich das dann vernünftig auf einem guten Niveau einpendelt. Ich bin da optimistisch, weil wir einfach sehr, sehr viele Koronarangiografien haben, viele bei stabiler KHK, zu viele invasive Eingriffe. Wir haben in diesem Bereich eine Überversorgung und haben jetzt eine gute diagnostische Alternative an der Hand, die nichtinvasiv ist und dann – da kommen wir vielleicht noch zu, Herr Nößler – auch so ein bisschen abgrenzen muss gegenüber funktionellen Verfahren. Also die Frage ist immer, wie sieht es denn im Alltag aus, wie sieht die Risikostratifizierung in der 1:1-Situation aus, in der Konsultation, welche Rolle spielt der Marburger Herz-Score, wann mache ich was. Und da sollten wir später vielleicht noch mal drauf zu sprechen kommen.
Nößler: Dann machen wir das sofort, würde ich sagen. Also es gibt ja in der NVL KHK einen relativ, ich nenne ihn jetzt mal liebevoll krassen Algorithmus, an dem man sich entlangarbeiten kann.
Scherer: Also nicht den Gassen-Algorithmus?
Nößler: Nein, den krassen Algorithmus. Ich weiß nicht, ob es auch einen Gassen-Algorithmus gibt. Nein, es gibt in der NVL Chronische KHK – verlinken wir auch in den Shownotes, die ist erst just Ende letzten Jahres aktualisiert worden – ein Algorithmus, an dem man sich entlanghangeln kann, der braucht eine ganze Seite. Ich habe mich tatsächlich auch eins-, zweimal vertan. Und das war genau das, was Sie angesprochen haben bei der Abgrenzung zu den funktionellen Verfahren. Wenn man da nicht hier und da vielleicht genau hinschaut, dann rutscht man ab. Können Sie es vielleicht noch mal ein bisschen fein machen, so zum Mitnehmen? Das, was Sie angesprochen haben.
Scherer: Vielleicht setzen wir es ein bisschen weiter vorne an, Herr Nößler. Wir schreiten zum Äußersten und reden mit der Patientin oder dem Patienten. Was halten Sie davon? Und da spielt der Marburger Herz-Score natürlich eine große Rolle. Sie wissen, wir sind Fans davon. Der Marburger Herz-Score hat fünf Punkte. Und Sie wissen auch, ich liebe es, Sie bei so etwas abzufragen. Kennen Sie die fünf Punkte des Marburger Herz-Scores?
Nößler: Ich glaube, es ist der Brustschmerz, der sich belastungsabhängig darstellt natürlich. Dann ist es das Geschlecht, was wir wissen, das bei KHK sehr relevant ist. Ich meine, es ist nicht nur das klinische Bild, sondern auch anamnestisch. Sprich: Habe ich irgendwas vorliegen, vaskuläres und kann man Schmerzen reproduzieren. Also so. Irgendwas fehlt noch. Das waren jetzt vier.
Scherer: Ja, der Patient. Was vermutet der Patient. Ja, das sind die fünf Punkte. Also Männer ab 55 oder Frauen ab 65 Jahre. Da gibt es schon mal einen Punkt. Bei einer bekannten kardiovaskulären Ursache gibt es einen Punkt. Wenn er durch körperliche Belastung auslösbar ist, gibt es einen Punkt. Wenn der Schmerz nicht palpatorisch reproduzierbar ist, gibt es einen Punkt. Und wenn der Patient selber auch eine kardiale Ursache vermutet, gibt es einen Punkt. Und jetzt müssen wir nämlich, Herr Nößler, über Vorteilswahrscheinlichkeiten reden. Wenn wir 0 bis 1 Punkt haben, dann haben wir eine niedrige Vorteilswahrscheinlichkeit von unter 5 Prozent, dann ist auch keine weitere Diagnostik nötig, da die Wahrscheinlichkeit von einer KHK auch vernachlässigbar ist. Bei 2 bis 3 Punkten haben wir eine moderate Vorteilswahrscheinlichkeit von 10 bis 20 Prozent. Und da ist dann auch ein Bereich, wo in der Praxis viel Unsicherheit ist. Das ist genau die Stelle, Herr Nößler, wo ein nichtinvasiver Test sinnvoll ist. Zum Beispiel das Koronar-CT oder das Belastungs-EKG. Ein Koronar-CT könnte in dieser Gruppe besonders wertvoll sein, weil es eben nicht nur die obstruktiven, sondern auch die nichtobstruktiven Plaques zeigt, die dann auch mal zum Infarkt führen können. Und das ist eigentlich der entscheidende Unterschied zum Belastungs-EKG. Ja, das Belastungs-EKG kostet weniger, es ist auch nicht invasiv, hat keine Strahlenbelastung. Es ist ein funktionelles Verfahren und kann zusätzlich die Belastungsintoleranz abbilden. Aber es ist diagnostisch nicht so genau wie das Koronar-CT. Es hat eine relativ hohe Rate an falsch positiven und falsch negativen Befunden. Und noch mal: es detektiert nur hämodynamisch relevante Stenosen und keine nichtobstruktiven Plaques. Das ist also der Bereich, in dem wir uns bewegen. Marburger Herz-Score 2 bis 3 Punkte. Bei 4 bis 5 Punkten liegt die Vorteilswahrscheinlichkeit bei über 50 Prozent, dann ist die KHK umso wahrscheinlicher. Da kann man dann überlegen: direkte kardiologische Abklärung oder auch hier Koronar-CT.
Nößler: Da sagt die DEGAM – wenn ich das richtig erinnere, korrigieren Sie mich bitte – auch ab 50 Prozent wäre eine CCTA zu erwägen, während die NVL da – so liest es sich jedenfalls – schon mehr Richtung Katheterlabor stupst.
Scherer: Ja, das stimmt. Also das muss man dann vom klinischen Einzelfall abhängig machen. Was uns wichtig ist, ist, dass wir mit diesem nichtinvasiven Verfahren wirklich eine neue Option haben, die Versorgung zu verbessern. Und wir konzentrieren uns dabei auch eher auf das intermediäre Risiko. Und möchten dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten mit einem intermediären Risiko – das ist diese Vorteilswahrscheinlichkeit von 15 bis 50 Prozent – als Goldstandard dann eben die CCTA oder das Koronar-CT erhalten. Und so steht es auch in der nationalen Versorgungsleitlinie.
Nößler: Also die letzte Version der NVL KHK haben wir in die Shownotes reingepackt. Alle hausärztlich erfahrenen und Evidenz-Fans mögen es mir verzeihen, dass ich die fünf Punkte MHS nicht so brillant auf Taste hatte. Für alle Vorbeigelaufenen packen wir einfach mal einen Link noch mit da rein. Kann ja nicht schaden. Ich erinnere mich auch – aber das wäre schon wieder fast eine eigene Podcast-Episode wert – an einen Vortrag bei der DEGAM-Tagung in Würzburg, wo ein Radiologe von der dortigen Uniklinik auch zur CCTA gesprochen hat. Und der sagte auf Stichwort nichtobstruktive Plaques: Das Ganze ist nicht nur von der Befunderqualität am Ende auch maßgeblich abhängig, was man da sieht und wie man den Befund interpretiert, sondern auch von der technischen Qualität. Und die Qualität kann natürlich fürchterlich variieren. Wenn ich jetzt ein Supramaximalversorger habe mit einer ambulanten Radiologie oder eine kleinere radiologische Praxis. Aber das wäre vielleicht noch mal eine eigene Episode. Herr Scherer, wollen wir noch mal zurückkommen, nachdem Sie eigentlich schon so eine Take-Home-Message jetzt formuliert haben, wollen wir noch mal kurz in ein, zwei Details von SCOT-HEART reinschauen. Ich würde nämlich gern noch einen Gesprächsgast mit einführen, wenn Sie gestatten.
Scherer: Sehr gerne. Ein Überraschungsgast.
Nößler: Ein Überraschungsgast. Ich kann ihn nur zitieren. Er ist leider nicht live dabei. Und zwar ist es John Mandrola – etliche werden ihn kennen. Er hat einen eigenen Podcast, er hat einen eigenen Blog, ist US-Kardiologe. Und er hat tatsächlich diese Zehnjahresdaten kommentiert – verlinken wir auch natürlich –, weil er sich auch schon früher mit SCOT-HEART beschäftigt hat und der glaubt dem ganzen Braten nicht so recht. Und der hat schon vor acht Jahren Zweifel gehabt, wie eine Diagnostik Infarktraten um so krass relativ 41 Prozent senken können soll. Ich zähle mal ein paar Punkte auf, die er genannt hat. Das eine ist, er sagt, SCOT-HEART sei ein Ausreißer. Er selbst hat mit Kollegen eine Meta-Analyse, systematischen Review vorgelegt, wo sie diesen starken Effekt in anderen Untersuchungen so nicht finden konnten, allerdings natürlich überall auch sinkende MI-Raten, so wie Sie es eben schon gesagt haben. Allerdings haben die auch Arbeiten gefunden, wo man eine PCI-Überversorgung nach der CCTA finden konnte. Sie hatten eben gerade über Dänemark gesprochen. Was sagt Mandrola noch? Er vermutet, es könnte eine Stichprobenverzerrung geben durch eben dieses Open-Label-Design. Sie haben es angedeutet, Beeinflussung der Prüfärzte, Beeinflussung der Probanden. Dann sagt er: Der entscheidende Faktor ist wahrscheinlich der geänderte Lebensstil, also Statine et cetera, wo er sich aber fragt, wie kann der Unterschied so groß sein bei Statinen. Und dann geht er noch tiefer – das will ich jetzt gar nicht alles zitieren –, der nimmt den P-Wert und sagt, wenn man den angepasst hätte mit einer Bonferroni-Berechnung wäre das nicht mehr signifikant. Ohne dass wir da jetzt in jedes Detail einsteigen können – wir verlinken den Artikel, dann kann ihn jeder lesen, der ist öffentlich zugänglich –, wie bewerten Sie die Vermutungen, die er anstellt?
Scherer: Fangen wir mal mit der Bonferroni-Korrektur an.
Nößler: Von hinten.
Scherer: Also das ist nicht gerade statistische Champions League, sondern ein absolut basales Verfahren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das durch einen Rost gefallen ist bei den statistischen Analysen. Auch wenn es hier vielleicht nicht berichtet wurde, aber das ist nun mal wirklich statistisches Handwerkszeug. Ich wäre vorsichtig, mich daran aufzuhängen und zu sagen, die haben das nicht gemacht. Das ist schon mal das Erste. Weil das einfach statistische Basics sind. Das andere – ja, er hängt sich an diesen spektakulären Risikoreduktionszahlen auf. Und das machen wir immer wieder gerne. Und ich glaube, wir haben schon in unseren ersten Podcast-Episoden darauf hingewiesen, dass die Pharmafirmen immer gerne die relative Risikoreduktion zitieren.
Nößler: Auch die Medtech-Firmen und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gerne tolle Ergebnisse präsentieren wollen.
Scherer: Und dann haben wir zweistellige, manchmal sogar hoch zweistellige Zahlen. Wenn wir das dann umrechnen in eine absolute Risikoreduktion, dann kommen wir bei niedrigen einstelligen Zahlen raus. Und da stellt sich natürlich die Frage: Ist das alles noch klinisch relevant? Ist das überhaupt noch ein Gamechanger? Aber es wird, wie ich eingangs schon gesagt habe, durch das Gesamtpaket zu einem Gamechanger. Also durch die Kontextualisierung im Versorgungsablauf, dadurch wird es zum Gamechanger. Und trotz der berechtigen methodischen Kritik bleibt natürlich eine Sache bestehen. Es gibt ja auch Metaanalysen, die für die CCTA tendenziell weniger Infarkte zeigen als bei den funktionellen Tests. Also man kann diese Studie kritisieren, aber ich glaube, der Effekt ist schon da. Wenngleich dann auch immer nicht so klar ist, wie der jetzt zustande kommt. Ist es die verstärkte Awareness in der Lebensführung, sind es vielleicht doch die beneficial drugs. Das höhere Ansetzen insgesamt mit der präventiven Strategie. Man weiß es nicht. Aber ein Punkt hat er noch, und das ist eben genau dieser Open-Label-Design-Aspekt, den wir am Anfang hatten.
Nößler: Ich plädiere nach wie vor für die Sham-CT.
Scherer: (Sound)
Nößler: Super. Jetzt weiß ich, wie ich da die Kavallerie auf den Plan rufen kann: mit der Sham-CT.
Scherer: Allerdings muss ich Wasser in den Wein gießen. Ich sehe da Probleme bei der Umsetzung und habe deshalb noch diesen Sound für Sie. (Sound)
Nößler: Okay. Gut. Wir befinden uns wieder im Comic Wunderland, wo man Sham-CTs sich mal eben so denken kann, aber das dann in der Realität einfach konfligiert. Ich finde das einen spannenden Punkt, weil Sie widersprechen Mandrola nicht grundsätzlich in seinen Gedanken, sondern es sind zwei verschiedene Arten, das auch zu interpretieren. Und wenn ich es richtig sehe, ist es auch eine Frage des Endpunkts, der mich interessiert. Während Mandrola vor allem auf den Endpunkt Vermeidung von Myokardinfarkten schaut, sehen Sie ja noch einen ganz anderen Endpunkt, der für Sie offensichtlich sehr viel relevanter ist. Das ist Überversorgung zu reduzieren.
Scherer: Dazu kann ich nur sagen: Genau.
Nößler: Perfekt. Ein Mann, ein Wort. Vielleicht noch die Auflösung von eben, damit wir zum Ende kommen können. Number needed to diagnose ist dann vielleicht jetzt nicht das Primäre, was man sich anschauen will, aber eins durch ARR – es sei noch aufgelöst – 62,5 Diagnosen in zehn Jahren, um einen akuten nicht tödlichen Myokardinfarkt zu verhindern. Das können wir aus den Zehnjahresdaten ableiten. Martin Scherer, eine Zusammenfassung, eine Take-Home-Messenges. Was können wir aus dem Gespräch heute mitnehmen? Was können Ihre Kolleginnen und Kollegen für den klinischen Alltag mitnehmen?
Scherer: Das klassische Denken bewegt sich immer zwischen den Polen Benefits and Harms. Die Benefits der CCTA sind sicherlich die Möglichkeit einer früheren KHK-Diagnose mit der Option, dann die Therapie zu präzisieren, weniger späte Myokardinfarkte und weniger unnötige invasive Diagnostik. Das sind ganz klar die Benefits. Bei den Harms haben wir natürlich eine potenzielle Übertherapie durch früh erkannte, nichtobstruktive Plaques. Bei den Kosten und der Verfügbarkeit gibt es natürlich Fragen, wie sieht das mit der Kosteneffizienz aus. Und die ist noch unklar. Und bei der Verfügbarkeit, es wird nicht überall umsetzbar sein. Die Wartezeiten sind da, ich glaube, die liegen im Durchschnitt so bei einem Monat für Kassenpatienten. Aber das wird möglicherweise dann noch mehr werden, wenn diese Methode sich noch mehr rumspricht. Ja, und dann ist natürlich so eine Abwägung, die Strahlenbelastung versus diagnostischen Gewinn. Man hat da eine erhöhte Strahlenbelastung, das ist so. Allerdings hat man natürlich auch in der Koronarangiografie eine gewisse Strahlenbelastung. Also Fazit für die Praxis, hatten Sie mich drum gebeten: Die CCTA ist sinnvoll bei mittlerem Risiko. Marburger Herz-Score so 2 bis 3 Punkte. Nicht als Screening-Tool, ganz sicher nicht. Also man muss es gezielt einsetzen bei unklaren Fällen. Und Hausärztinnen und Hausärzte sollten schon den Stellenwert der CCTA kennen, aber jetzt nicht überbewerten. Und eine Sache, Herr Nößler, die fällt mir jetzt ganz zum Schluss ein: Für Schwellenwerte gibt es nicht wirklich eine Evidenz. Wir können jetzt keine Studie zitieren, die sagt: Bei 15 Prozent musst du unbedingt dann gleich das CCTA machen, bei 15 Prozent Vorteilswahrscheinlichkeit. Wir empfehlen das beim intermediären Risiko, ja. Aber es gibt weder für die 15 Prozent Vorteilswahrscheinlichkeit noch für irgendeine andere Zahl eine klare Evidenz oder überhaupt eine Studie, die das so dann auch bestätigt.
Nößler: Da ist dann das klinische Bild und das Gespräch richtungsweisend. Gut. Wunderschöne Zusammenfassung über ein Gespräch über die SCOT-HEART Studie und vieles andere. Wie immer könnten wir uns in tausend anderen Aspekten verlieren. Das werden wir in der einen oder anderen Folge noch machen. Ich würde sagen, Martin Scherer, machen wir an der Stelle Schluss für heute. Und Sie dürfen es mal wieder, und jetzt aber mal endgültigen, Cliffhanger versuchen, den wir eigentlich schon seit Monaten bringen.
Scherer: Ich glaube, wir haben schon die Niere, die CKD, die Chronic kidney disease mehrfach ans Cliff gehängt und mehrfach schon versprochen, die dann zu thematisieren mit meinem Freund Jean Chenot, der maßgeblich von DEGAM-Seite an dieser Leitlinie beteiligt war. Man muss das halt immer timen, wann ist die Leitlinie publiziert und wann passt es. Wir haben dann ja auch im März ein Weltnierentag. Ich glaube, der 13. März ist der Weltnierentag, da müssen wir dann mal gucken, dass wir das dann auch vorher schaffen. Es gab im Dezember übrigens ein World Nothing Day.
Nößler: Wann ist der World Nothing Day?
Scherer: Da muss ich noch mal nachschlagen.
Nößler: Dass es so was überhaupt gibt. Gefühlt gibt es ja für alles Welttage. Ich habe hier einen gelben Notizblock liegen. Und wahrscheinlich gibt es auch einen Welttag für gelbe Notizblöcke, oder?
Scherer: Und wissen Sie, was heute ist?
Nößler: Heute ist Dienstag, der 4. Februar. Was ist da für ein Tag? Also Sie finden wahrscheinlich mindestens zehn Welttage jetzt. Martin Scherer sucht gerade.
Scherer: Heute ist der Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung. Kulturelle Vielfalt, Herr Nößler. Und jetzt wollten Sie mit mir in diesem Podcast über so schnöde Dinge wie KHK und CCTA sprechen und nicht über die Ereignisse der letzten Woche und über Vielfalt und Pluralismus. Heute ist der Welttag der kulturellen Vielfalt.
Nößler: Ich sage mal so: Auch unser Gespräch könnte dem ja beitragen.
Scherer: Und wie?
Nößler: Na ja, indem wir überlegen, das Ganze nennt man ja Dialektik. Und es gibt ja auch diagnostisch kulturelle Vielfalt.
Scherer: Na, in diesem Sinne.
Nößler: In diesem Sinne, Martin Scherer, vielen Dank! Also wir kümmern uns um die Nierchen.
Scherer: Da sind wir aber wieder beim Irrgartenbild und nicht bei dem Bild des roten Fadens und der Leitplanken und der Bahngleise.
Nößler: Machen wir. Martin Scherer, vielen Dank! Bis dann! Und tschüss!
Scherer: Tschüss!