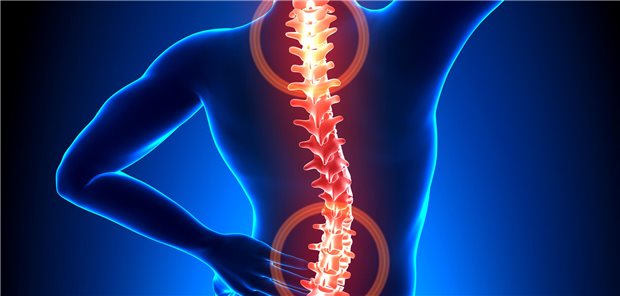Interview
AOK-Chefin Reimann: „Entbudgetierung ist nicht zielführend“
Seit Januar steht mit Dr. Carola Reimann (54) erstmals eine Frau an der Spitze des AOK-Bundesverbands. Im Gespräch mit der Ärzte Zeitung erklärt die frühere Gesundheits- und Sozialpolitikerin, wo sie die Ärzteschaft in der Pflicht sieht – und welche einfache Alternative es zu einem Corona-Impfregister gibt.
Veröffentlicht:
Dr. Carola Reimann ist seit Januar 2022 Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes.
© Stephanie Pilick
Ärzte Zeitung: Frau Dr. Reimann, wie fühlt sich die Rückkehr in die Bundespolitik an?
Dr. Carola Reimann: Sehr gut! Ich verfüge über Erfahrungen auf der Bundes- wie der Landesebene. Das kommt mir bei der neuen Aufgabe hier im AOK-Bundesverband sehr zugute. Natürlich sind die Zeiten herausfordernd für die Kassen. Aber es ist auch eine Zeit, in der es gute Lösungen mehr denn je braucht. Und mein Ansporn ist, mich daran zu beteiligen.
Corona beschäftigt uns nun – fast auf den Tag genau – seit zwei Jahren. Aktuell diskutiert der Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht. Gefordert wird auch der Aufbau eines Impfregisters, was aber als komplexe Veranstaltung gilt. Könnten die gesetzlichen Krankenkassen, bei denen rund 70 Millionen Bundesbürger versichert sind, nicht Abhilfe schaffen?
Ja, wir haben dazu einen konkreten und pragmatischen Vorschlag: Jede Impfung gegen Corona sollte mit der Versichertennummer verknüpft werden. Bei anderen Schutzimpfungen werden Impfdaten ja auch mit Routinedaten der Kassen verknüpft. Auf diese Weise wären die Kassen in der Lage, eine ordentliche Corona-Impf-Surveillance zu unterstützen.
Das ist keine Raketenwissenschaft, sondern ließe sich relativ schnell und aufwandsarm umsetzen. Dafür braucht es kein separates Register. In der Perspektive wird die Corona-Impfung ohnehin in den Impfkanon der Regelversorgung einmünden müssen. Das muss man jetzt vorbereiten. Es hilft uns ja nichts, die Omikron-Welle zu überstehen, aber in der Perspektive nichts in der Hand zu haben.
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) untersagt den Kassen die Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten ohne konkreten gesetzlichen Auftrag. Wie wollen Sie über diese Hürde kommen?
Grundsätzlich ist es so, wie Sie sagen. Aber die DSGVO definiert auch Ausnahmen. Personenbezogene Gesundheitsdaten dürfen aus „Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ durchaus verarbeitet werden. Solche Angaben können etwa „für humanitäre Zwecke einschließlich der Überwachung von Epidemien und deren Ausbreitung“ erforderlich sein. Das trifft auf die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und deren Begleiterscheinungen wohl definitiv zu. Am Zug wäre jetzt der Gesetzgeber. Er müsste die Impfverordnung entsprechend anpassen und den Krankenkassen eine entsprechende Aufgabe, also einen Datenverarbeitungszweck, zuweisen. Dann könnten die Kassen die Daten gegen Corona bündeln und die Impfkampagne aktiv unterstützen. Die Impfstoffdaten unterscheiden sich auch nicht von anderen Arzneimitteldaten, die Krankenkassen im Rahmen der Abrechnung mit großer Routine ja ohnehin personenbezogen verarbeiten.
Etliche Kassen haben zum Jahresbeginn 2022 den Zusatzbeitrag angehoben – darunter mehrere AOK. Ist das ein Vorgeschmack darauf, dass Gesundheit bald deutlich teurer wird?
Wir sehen ein erhebliches strukturelles Defizit. Und wir müssen schon erwarten, dass das auch im kommenden Jahr so sein wird. Vieles ist mit großen Unwägbarkeiten behaftet.
Wir alle haben den Koalitionsvertrag gelesen, wissen aber nicht, wie schnell welche Maßnahmen und Instrumente umgesetzt werden. Auf der Einnahmenseite enthält der Vertrag Dinge, die Linderung verschaffen könnten. Dazu gehören die geplanten höheren Beiträge aus Steuermitteln für ALG-II-Beziehende. Da geht es um ein Volumen von rund zehn Milliarden Euro. Darüber hinaus braucht es die regelhafte Dynamisierung des Bundeszuschusses zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
Befördert die angespannte Kassenlage den Strukturwandel oder bremst er ihn aus? Beides ist ja denkbar.
So paradox es klingt: Ich denke, die Situation treibt den Wandel voran und erzwingt Veränderungen. Not macht bekanntlich erfinderisch.

AOK-Chefin Dr. Carola Reimann im Gespräch mit Denis Nößler (r.) und Thomas Hommel (l) von der Ärzte Zeitung.
© Stephanie Pilick
Gehören weitere Kassenfusionen auch dazu?
Wir sind ja schon bei unter 100. Bei den Kassen sehe ich gar nicht so sehr die Notwendigkeit, das Angebot zu verändern. Es gibt andere Leistungserbringer, und hier sind vor allem die Kliniken adressiert , bei denen es echte Strukturreformen braucht.
Kommen wir noch einmal auf das Defizit der GKV zu sprechen: Der Gesundheitsökonom Professor Jürgen Wasem rechnet mit 75 Milliarden Euro, die den Kassen bis 2030 fehlen. Läuft das nicht auf Kostendämpfung, sprich Leistungskürzungen hinaus?
Leistungskürzungen hat die Ampel-Koalition ja ausgeschlossen. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich hierzu gleich zu Amtsantritt klar positioniert. Und das heißt natürlich, man muss zu klügeren Einsparungen kommen.
Welche könnten das sein?
Einsparungen im Arzneimittelbereich, das liegt auf der Hand. Die Weiterentwicklung des AMNOG ist das eine Thema, die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf Arzneimittel und die Anhebung des Herstellerrabatts für patentgeschützte Arzneimittel zwei andere. Allein diese von uns vorgeschlagenen Schritte haben ein Einsparvolumen von rund sieben Milliarden Euro. Faire Arzneimittelpreise sind ein wirklich großes Thema aus unserer Sicht. Auch die Diskussion über die Orphan Drugs müssen wir noch einmal führen. Da schlummert erhebliches Potenzial.
Wie stark forciert die Pandemie die Kostenwelle, die auf Kranken- und Pflegekassen zurollt?
Das lässt sich noch nicht genau abschätzen, da es zwei gegenläufige Entwicklungen gibt: Auf der einen Seite führt die Pandemie zu Mehrausgaben – etwa durch Aufwendungen für Schutz- und Hygienematerialien oder Gelder für diverse Schutzschirme. Zum Teil schießt der Bund Steuermittel dazu, aber ein dicker Brocken bleibt bei den Kassen hängen. Auf der anderen Seite werden von den Versicherten im Moment bestimmte Leistungen nicht oder in reduzierter Form abgerufen.
Steht also zu befürchten, dass es infolge der Pandemie zu einem Morbiditätswall kommt? Nicht wahrgenommene Früherkennung, aufgeschobene Operationen, ausbleibende Arztbesuche – rächt sich das?
Das befürchte ich. Das kostet dann nicht nur Geld, sondern es verursacht vor allem Patientenleid. Das Wissenschaftliche Institut der AOK hat vor ein paar Wochen eine Auswertung zur Inanspruchnahme von Vorsorgeangeboten vorgelegt. Die AOK adressiert das Thema Vorsorge ja im Rahmen ihrer Dachkampagne „Deutschland, wir müssen über Gesundheit reden!“ – auch weil es für viele noch immer ein Tabuthema ist. Wir sehen, dass Vorsorgeuntersuchungen insbesondere bei Männern noch weiter nachgelassen haben. Die ausgebliebene Diagnostik in der Pandemie führt in der Konsequenz dazu, dass Krankheiten wie Darmkrebs womöglich erst in einem späteren Stadium erkannt werden – mit all den Folgen, die das dann für die Patienten haben kann.
Der Morbi-RSA war in der vergangenen Legislaturperiode ein Riesenthema. Aktuell sorgt das sogenannte Up-Coding wieder für Schlagzeilen. In Hamburg liegt eine Anklage gegen mehrere Vorstandsmitglieder der dortigen AOK vor. Wie lassen sich Fehlanreize im System beseitigen?
Zunächst ein Wort zu Rheinland/Hamburg. Das ist eine alte gerichtliche Auseinandersetzung von 2016. Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat 2017 klargestellt, dass es sich nicht um Up-Coding handelt. Das Aufgreifkriterium waren Arzneimittelverschreibungen ohne Diagnose – und das kann in der Hektik eines Praxisalltags schon mal passieren.
Unabhängig davon sehen wir weiter Fehlanreize im System des Kassenfinanzausgleichs. Sozioökonomische Aspekte müssen hier wieder eine viel größere Rolle spielen. Das wird im aktuellen Morbi-RSA sträflich vernachlässigt. Dabei wissen alle, dass sozioökonomischer Status und Erkrankungswahrscheinlichkeit eng zusammenhängen.
Ein Streitpunkt in der RSA-Debatte sind auch unterschiedliche Aufsichten – hier das BAS für die Bundeskassen, dort die Länder für die Ortskrankenkassen. Braucht es eine einheitliche Aufsicht oder soll es so bleiben, wie es ist?
Sie sprechen mit einer ehemaligen Landesministerin für Gesundheit – und deshalb meine ich schon, dass die Länderaufsicht über die AOK eine angemessene und gut funktionierende Aufsicht ist. Regionalität, ein wichtiges Kriterium in der Versorgung, lässt sich so viel besser darstellen. Im Übrigen ist es ja nicht so, dass es keine Abstimmung zwischen den Aufsichten geben würde. Die Aufsichtsbehördentagung findet mehrmals im Jahr statt. Der Gesetzgeber hat da ja auch noch einmal nachgeschärft.
Zuletzt hat die Forderung der AOK, die mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) eingeleitete Entbudgetierung wieder zurückzunehmen, die Ärzte verärgert. Das zeuge von Knauserei und Trickserei, kritisiert der Sprecher der Allianz Deutscher Ärzteverbände, Dr. Dirk Heinrich. Was entgegnen Sie?
Wir möchten mit den Ärzten einen sachlichen Dialog über das Thema führen, nicht polemisieren. Schaut man sich die Sache nüchtern an, stellt man fest: Der Anteil budgetierter Leistungen wird immer kleiner. Eine Entbudgetierung, so wie sie auch im Koalitionsvertrag steht, ist nicht zielführend. Wollen wir eine ambulante ärztliche Versorgung auch in der Fläche erhalten, müssen wir über andere Lösungen nachdenken. Da ist Geld nicht das zentrale Thema – das spiegeln mir zumindest Ärzte, die in der Fläche tätig sind. Es geht vielmehr um Arbeitsteilung, um Arbeit in multiprofessionellen Teams und um eine gute Work-Life-Balance für junge Ärzte. Darüber können wir zu einer besseren Versorgung gelangen.
Sie würden mit Herrn Heinrich lieber über Strukturen als über Geld reden?
So ist es. Das ist natürlich nicht leicht für die Ärzteschaft, wenngleich die Basis dazu bereit ist und die Arbeit in neuen Strukturen schon vorlebt. Diskutieren Sie das Thema mit Vertretern aus Verbänden, wird es schwerer.
In Hessen, wo Mittel in der Gesamtvergütung übrig waren, ist eine Strukturpauschale aufgelegt worden. Wäre das ein denkbarer Weg?
Die Rahmenbedingungen sind ja derzeit so, dass wir kein Geld übrighaben. Das limitiert die Möglichkeiten. Aber klar ist: Wir müssen über andere Strukturen reden. Das hat ja auch etwas damit zu tun, regionale Versorgungsaufträge zu geben und dafür alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, um gemeinsam die Versorgung in der Region zu stemmen. Das ist die Aufgabe für die nächsten Jahre. So weiterzuarbeiten wie bisher, geht nicht. Weil wir die Ärzte nicht haben, und die anderen Gesundheitsberufe auch nicht.
Die Ersatzkassen haben die nach wie vor langen Wartezeiten auf Facharzttermine angeprangert. Genau das Problem sollte mit dem TSVG abgemildert werden. Machen Sie sich die Kritik zu eigen?
Die Befragungen zu Wartezeiten bei Fachärzten zeigen ja, dass die Patienten nach wie vor unzufrieden sind. Das TSVG hat sehr viel Geld für eine schnellere Terminvergabe durch die Praxen in Aussicht gestellt – rund 800 Millionen Euro. Aber die Patienten merken davon nichts. Das muss man schon zur Kenntnis nehmen. Und an diesem Problem müssen wir weiterarbeiten.
Die Ampel hat die Klinikreform auf die Agenda gesetzt – was erwartet die AOK von der Koalition?
Wir brauchen echte Strukturreformen im Krankenhausbereich. Wir reden da schon lange drüber. Meine feste Überzeugung in der Frage – auch als Landesministerin – war immer: Wir brauchen mehr Spezialisierung, Konzentration und Kooperation. Der AOK-Bundesverband hat hierzu konkrete Vorschläge gemacht. Wir sind bereit, mit Blick auf die Planung der Krankenhausstrukturen stärker in die Verantwortung zu gehen.
Sie zielen auf das 3+1-Gremium ab – bestehend aus Kassenärztlichen Vereinigungen, Landeskrankenhausgesellschaften, Krankenkassen und dem jeweiligen Bundesland als unparteiischem Mitglied?
Korrekt. Wir wollen die Debatte über die sektorenübergreifende Versorgung endlich mit Leben füllen. Wir reden da ja schon viele, viele Jahre drüber. Und da sind die Hürden und Hindernisse auch sehr hoch. Aufzulösen ist das unserer Überzeugung nach nur auf der regionalen Ebene. Dort müssen sich die genannten Akteure an einen Tisch setzen und Lösungen finden. Das ist schon ein neuer Ansatz, dass die Kassen hier mit in die Verantwortung gehen wollen.
Als ehemalige Landespolitikerin wissen Sie selbst: Oft scheitern die Bemühungen um einen Klinikumbau am Widerstand der Länder.
Hier ist in der Tat eine Kommunikationsleistung zu erbringen, die wir bisher nicht geleistet haben: Eine Strukturreform im Krankenhausbereich darf kein Wahlkampfthema oder besser Wahlkampfrisiko auf der Landesebene oder der lokalen Ebene sein. Das passiert aber in vielen Fällen.
Was stärker nach vorne gestellt werden muss stattdessen, das ist die Botschaft: Mit der Umwandlung kleinerer Häuser in ambulante Gesundheitszentren – ausgestattet womöglich mit einer Kurzliegerstation etwa für ältere Menschen – kann die Patientenversorgung sogar besser werden. Darum geht es doch. Die Struktur eines alten Kreiskrankenhauses mit einer veralteten technischen Ausstattung kann die Versorgung nicht qualitativ hochwertig sicherstellen.
Treibt die Verknappung an Fachkräften den Strukturwandel voran?
Das ist meine feste Überzeugung. Spezialisierung und Zentralisierung helfen uns, das vorhandene medizinische und pflegerische Personal besser und gezielter einzusetzen. Wir verteilen das vorhandene Pflegepersonal im Moment auf zu viele Kliniken. Das führt zu einem relativen Mangel und zu personellen Engpässen.
Das Interessante ist ja, dass die Dichte der Ärzte pro Einwohner seit Jahren steigt. Berlin hat drei Herzzentren. Der KBV-Vorstand hat in der Ärzte Zeitung gefordert, legen wir das doch zusammen und kaufen ein paar Hubschrauber. Wäre das ein Ansatz?
Na ja, Hubschrauber vielleicht nicht gleich. Aber zur Wahrheit gehört, dass man über eine höhere Patientenmobilität sprechen muss. Dass Wege weiter werden, wenn wir spezialisieren und Kliniken zusammenlegen, muss jedem klar sein. Ich denke aber, dass viele Menschen bereit sind, ein paar Kilometer weiter zu fahren, wenn sie wissen, in diesem Krankenhaus arbeiten Ärzte und Pflegekräfte, die ihr Handwerk verstehen – auch weil sie zum Beispiel eine komplexe Prostata-Operation nicht nur hin und wieder, sondern häufiger machen.
Stärken will die Koalition sowohl die interprofessionelle als auch die intersektorale Zusammenarbeit – und schlägt dafür Gesundheitszentren vor. Klingt ziemlich abstrakt, oder?
Es gibt ja schon Projekte, wo solche Dinge konkret ausprobiert werden – wenn auch nicht flächendeckend. Ein Beispiel ist das lokale Gesundheitszentrum Niesky in Dresden, an dem die AOK PLUS beteiligt ist. Oder das Projekt IGiB-StimMT im Mittelbereich Templin, an dem die AOK Nordost mitwirkt. Der Bedarf an solchen Modellen ist da, viele Regionen begeben sich auf den Weg dorthin. Das ist Graswurzelbewegung, und die wird sich durchsetzen.
Aber mehr Zusammenarbeit wird schon seit Jahren gefordert – bis heute fördere das Sozialgesetzbuch V aber die Trennung der Sektoren und verunmögliche kooperative Versorgung, kritisiert der Arzt und DGIV-Vorsitzende Professor Eckhard Nagel. Stimmt seine Diagnose?
Ich sehe das SGB V eher als Regularium an Dingen, die der Gesetzgeber ermöglicht in der Versorgung, die aber von den Adressaten – Kassen, Ärzte, Länder, Kliniken – noch nicht wirklich vollumfänglich genutzt werden. Einen Steinbruch würde ich aus dem SGB V also nicht machen, eher rate ich zur gründlichen Lektüre, was schon alles ermöglicht wird.
Möglich ist die haus- und facharztzentrierte Versorgung. Ein Mitarchitekt des Ampel-Vertrages, Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha von den Grünen, lobt die Verträge als „Benchmark“ – im Koalitionsvertrag steht dazu kein Wort. Enttäuscht Sie das?
Ja, es hätte eine Präzisierung gebraucht. Für uns stecken die 73b-Verträge noch immer in einem zu engen Korsett fest. Wir sollten wieder zur Freiwilligkeit von hausarztzentrierten Verträgen neben der Regelversorgung zurückkehren. Und wir hätten gerne mehr regionale Gestaltungsmöglichkeiten, um Vernetzung und Kooperation zu fördern.
Die KBV hat sich in der Ärzte Zeitung für ein „Digital-Moratorium“ ausgesprochen. E-Rezept und eAU sollten gestoppt werden, die Telematikinfrastruktur gehöre auf den Prüfstand. Klingt das plausibel für Sie?
Digitalisierung ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf. Da hilft es jetzt nicht weiter, den Kopf in den Sand zu stecken. Mit Moratorien kommen wir nicht weiter. Das ist ein gemeinschaftliches Lernen aller Leistungserbringer. Und deshalb sollten wir uns weiter mutig auf diesen Weg begeben und nicht verzagt agieren. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass es Änderungen bei der gematik braucht. Die Gesellschaft ist derzeit sehr ohne die Expertise und Meinung der Leistungserbringer unterwegs. Das sollte man überdenken. Der Beitrag der Ärzteschaft und der Kassen sollte freilich konstruktiver Art sein.
Sollten sich demach die Anteile an der gematik verändern?
Nein, es geht mir um die Beteiligung. Momentan ist es so, dass diejenigen, die über das Wissen zu Prozessen und zur Technik dahinter verfügen, sich nicht gut vertreten fühlen.
Es gibt Gerüchte, wonach die KBV aus der gematik aussteigen will.
Das wäre keine gute Entscheidung. Es braucht mehr Gespräche und Zusammenarbeit. Sonst treten wir weiter auf der Stelle.
Die Ärzte fummeln derzeit mit Erdungskabeln in der Praxis herum und hoffen, dass Konnektoren nicht abstürzen. Das E-Rezept wäre ein Papiertiger geworden nach 42 Tests. Kurzum: Es gibt durchaus berechtigte Kritik. Müsste man also trotz Dauerlaufs nicht ab und an innehalten?
Natürlich muss man die Perspektive derer, die all das in der Praxis umsetzen sollen, berücksichtigen bei der Digitalisierung. Jetzt haben wir aber mit ePA, E-Rezept und eAU Anwendungen am Start, die einen echten, auch medizinischen Nutzen bringen und allen Beteiligten das Leben künftig leichter machen können. Das kann nur gelingen, wenn alle daran mitarbeiten, vorhandene Fehler zu analysieren und dann möglichst schnell aus dem Weg zu räumen.
Wann steht die ePA allen Bundesbürgern zur Verfügung?
Ich war vor 17 Jahren erstmals Mitglied des Bundestags, da war das schon ein Thema. Dass das jetzt dringend beschleunigt werden muss, führt die Pandemie ja deutlich vor Augen. Es wird aber noch eine ganze Weile dauern, bis die ePA flächendeckend genutzt wird. Wir müssen vor allem die Zugangshürden für die Patientinnen und Patienten abbauen, damit die ePA breite Akzeptanz findet. Die Opt-out-Regelung, die im Koalitionsvertrag vorgesehen ist und nach der künftig für alle Versicherten automatisch eine ePA angelegt werden soll, ist in diesem Zusammenhang auf jeden Fall ein richtiger und wichtiger Schritt. Die AOK jedenfalls wird alles dafür tun, dass Deutschland endlich mal zu Potte kommt bei der ePA.
Die Ärzte Zeitung wird 40. Was ist die wichtigste Voraussetzung, damit unsere Enkel ein resilientes Gesundheitswesen vorfinden?
Eine gesunde Kassenstruktur.
Was könnte dabei ein Problem sein?
Sektorengrenzen.
Was ist als erstes tun, um dies zu ändern?
Mehr Kooperation und Gesprächsbereitschaft.
Wir danken Ihnen für das Gespräch!
Dr. Carola Reimann
- Aktuelle Position: Seit Januar 2022 Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes
- Ausbildung: Studium der Biotechnologie an der Technischen Universität Braunschweig; 1993 Diplom; 1995 – 1999 Promotion
- Karriere/Funktionen: 2017 bis Februar 2021 Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Niedersachsen 2013 – 2017 Stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, zuständig für Arbeit und Soziales, Frauen, Senioren, Familie und Jugend 2000 – 2017 Mitglied des Bundestages