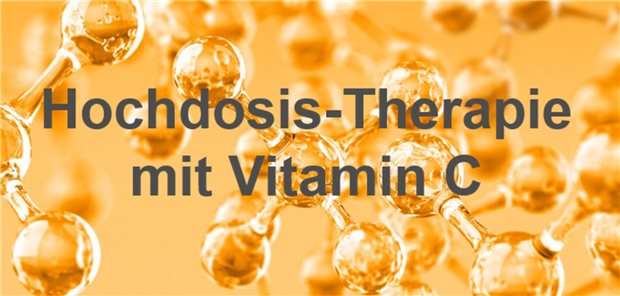Stochern im Dunkeln
Corona-Daten erheben: „Wir stehen uns selbst im Weg“
Wissenschaftler beklagen eine immer noch schlechte Datenlage in Deutschland, um Infektionsrisiken besser zu erkennen. Was hält die Politik von einer zielgerichteteren Datenerhebung ab?
Veröffentlicht:
Trotz App und Impfzertifikat: Nach wie vor stochert Deutschland auf der Suche nach den Wegen, die das Coronavirus nimmt, oft im Dunkeln. Das kritisieren Wissenschaftler (Symbolfoto).
© Weber/ Eibner-Pressefoto / picture alliance
Berlin/Halle. In welchen Gesellschaftsbereichen verbreitet sich das Coronavirus besonders stark? Welche Maßnahmen gegen das Virus wirken wie gut? Wissenschaftler beklagen, dass bisher wenig für die Beantwortung dieser Fragen getan worden ist. Nach wie vor stochere Deutschland bei der Suche nach den Wegen, die das Virus nimmt, oft im Dunkeln. Eine breitere Datenbasis würde aus der Sicht vieler Wissenschaftler helfen.
„Nur mit wissenschaftlichen Auswertungen, die (...) auf einer sehr breiten Grundlage basieren, können für die Politik die notwendigen Entscheidungshilfen in kürzester Zeit zur Verfügung gestellt werden“, sagt der Vorsitzende der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik, Tim Friede.
Datenschutz nur vorgeschoben?
Über die Gründe für die fehlende Arbeit an einer zielgerichteten und systematischen Datenerhebung kann Friede nur spekulieren. „Warum diese Ideen nicht umgesetzt wurden, kann ich mir nicht recht erklären.“ Auch eine Konfrontation mit dem oft ins Feld geführten Datenschutz sieht er nicht zwingend.
Er habe mehrmals erlebt, „dass eine wissenschaftliche Nutzung von Daten mit Verweis auf den Datenschutz verweigert wurde“, sagt Friede, der das Institut für Medizinische Statistik an der Universitätsmedizin Göttingen leitet, mit Blick auf das vergangene Jahr. Er habe gelegentlich den Datenschutz als vorgeschobenes Argument empfunden, um eine Veröffentlichung von Daten zu verhindern.
Großbritannien macht es vor
Dass die Erhebung großer Datenmengen bei COVID-19-Patienten möglich sei und Früchte trage, zeige Großbritannien. Eine Studie habe dort inzwischen über 40.000 Patienten eingeschlossen und damit eine Grundlage für evidenzbasierte Therapieempfehlungen weltweit geschaffen, sagt Friede.
Wichtig sei dabei die „Studien möglichst elegant in den klinischen Alltag“ einzubetten und diese Studien möglichst einfach aber groß anzulegen. Hier zeigten die Briten einen Pragmatismus, der in Deutschland manchmal fehle, bedauert Friede. „Gelegentlich habe ich gar den Eindruck, dass wir mit dem Streben, alles besonders exakt machen zu wollen, uns selbst im Weg stehen.“
Mehrere Fragen, unter anderem, warum bei der Ermittlung von Neuinfektionen nicht stets auch Daten zum Beruf, zum Arbeitsweg und den Wohnverhältnissen erhoben würden, ließ das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur weitgehend unbeantwortet. Es verwies lediglich auf das Infektionsschutzgesetz, das vorschreibe, welche Daten die Meldepflichtigen an die Gesundheitsämter zu übermitteln hätten.
Sorge um Haftung führt Politiker in die Defensive
Dass eine solidere statistische Grundlage tatsächlich zu den richtigen Maßnahmen bei der Pandemiebekämpfung führen würde, daran hat Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz in Potsdam, Zweifel.
Studien hätten gezeigt, dass wir in einer Gesellschaft lebten, die nicht darauf vorbereitet sei, statistisch zu denken. Das trage dazu bei, dass einige in Verschwörungstheorien abdrifteten. „Hier muss dringend etwas getan werden, es hilft nicht nur Daten bereitzustellen.“
Dabei sei es nicht so, dass Menschen in Notsituationen die Vernunft und das Zahlenverständnis abschalteten. Menschen seien selbst dann in der Lage Risiken abzuwägen. „Wenn man ihnen das beibringt“, schiebt Gigerenzer hinterher.
Bei verantwortlichen Politikern käme bei Entscheidungen noch ein anderer Faktor hinzu: Die Sorge um die Haftung veranlasse viele von ihnen, sehr defensiv zu agieren. Oft führten Haftungsbedenken zu falschen Entscheidungen, erklärt Gigerenzer. Da spiele sicher auch das Kalkül mit rein, bei der nächsten Wahl nicht abgewählt zu werden. (dpa)