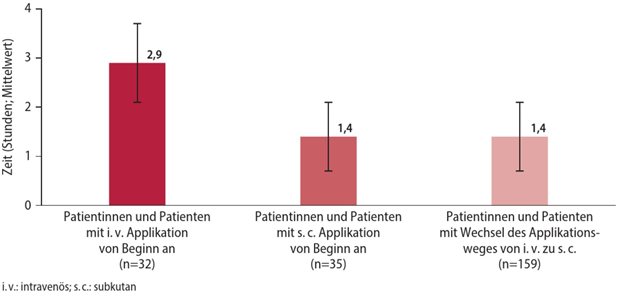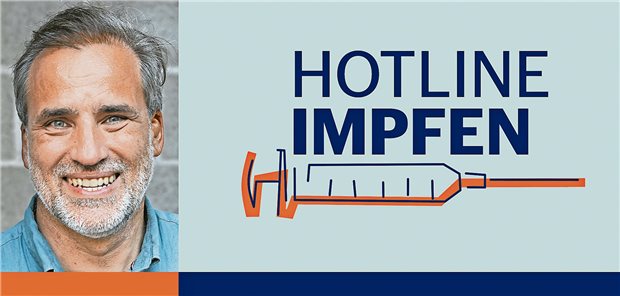Untersuchung
Corona: Wer Politiker berät, ist oft unklar
Seit dem Beginn der Corona-Pandemie haben zeitweise 21 Beratungsgremien Politiker in Bund und Ländern unterstützt. Wer sind diese Fachleute und was war ihr Rat? Eine Analyse zeigt Fakten auf.
Veröffentlicht:
Auf wen hören Politiker in der Corona-Pandemie? Eine Untersuchung hat die Zusammensetzung von Beratergremien beleuchtet. Oft im Fokus ist dabei der Einfluss des Virologen Christian Drosten (links), hier mit Gesundheitsminister Jens Spahn.
© Michael Kappeler / dpa
Berlin. Bundes- und Landesregierungen haben sich während der Corona-Pandemie durch insgesamt 21 Sachverständigenräte beraten lassen. Von vielen dieser Gremien ist nur der Name bekannt, nicht aber die der Mitglieder. Auch die Beratungsergebnisse dieser Expertengruppen sind ganz überwiegend nicht öffentlich.
Das geht aus einer Untersuchung von Dr. Karin Sell und Kollegen hervor, Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung am Institut für medizinische Informationsverarbeitung der LMU München, die jüngst online vorab in der Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen erschienen ist (Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswesen 2021; online 30. August, doi: 10.1016/j.zefq.2021.06.002).
Die Wissenschaftler haben dazu im Zeitraum von Mai bis November 2020 öffentlich verfügbare Informationen und Dokumente gescreent, darunter 5564 parlamentarische Anfragen in Bund und Ländern sowie mehr als 5100 Pressemitteilungen.
Frauen stark unterrepräsentiert
Sieben Bundesländer und vier Bundesministerien haben der Untersuchung zufolge Beratergremien eingesetzt, die „Expertenteam Corona“ (Rheinland-Pfalz), „Wissenschaftlicher Beirat“ (Thüringen) oder ähnlich hießen. Den Autoren sind mehrere Gemeinsamkeiten aufgefallen:
- Frauenanteil: Den Räten in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz gehörten überhaupt keine Frauen an. In allen anderen Gremien waren Frauen durchgängig unterrepräsentiert – ihr Anteil betrug im Durchschnitt 26 Prozent. Die Autoren bezeichnen dies als „problematisch“ – nicht nur im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit, sondern auch angesichts der Tatsache, dass Perspektiven und Erfahrungen von Frauen in der Pandemie bei der wissenschaftlichen Entscheidungsvorbereitung oftmals ohne Stimme blieben.
- Interdisziplinarität: In den Gremien, deren Mitglieder überhaupt namentlich bekannt waren, dominierten medizinisch-biologische Disziplinen wie Virologie oder Epidemiologie. Nur ausnahmsweise – wie beispielsweise in Thüringen – waren auch Vertreter aus den Bereichen Kommunikationswissenschaften, Ethik, Pädagogik oder Sozialpsychologie an den Beratungen beteiligt. Public Health als eigenständiger wissenschaftlicher Fachbereich war gar nicht vertreten. Die eingeschränkte Interdisziplinarität deckt sich mit der Beobachtung, dass insbesondere in der ersten Phase der Pandemie die sozialen und psychischen Folgewirkungen des Lockdowns in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten nur unzureichend reflektiert wurden.
- Transparenz über Beratungsergebnisse: Informationen über Art und Umfang der Zugänglichkeit von Beratungsergebnissen existieren für 4 von 21 Gremien. In nur zwei Fällen sind die Ergebnisse in Publikationen oder Stellungnahmen eingeflossen. Diese Befunde der Autoren schwächen das Signal, das Politiker mit der Einsetzung von wissenschaftlichen Beiräten eigentlich immer auch setzen wollen: nämlich dem Bekenntnis zur evidenzbasierten Entscheidungsfindung in der Pandemie.
Dass in nur zwei Bundesländern solche Gremien in den Pandemieplänen überhaupt vorgesehen waren, kann den Verdacht nähren, diese Beiräte hätten nur der nachträglichen Rechtfertigung der Lockdown-Politik gedient. Denn sie wurden überwiegend erst dann eingesetzt, als die Lockerung oder schrittweise Aufhebung von Lockdown-Maßnahmen anstand. Der nicht transparente Umgang mit wissenschaftlicher Politikberatung gerät vor allem dann in die Kritik, wenn angesichts anhaltender Grundrechtseinschränkungen der Legitimationsdruck auf die Politik steigt.
AfD hinterfragt Gremienbesetzung
Das zeigt auch das Ergebnis der Untersuchung: 52 Prozent der parlamentarischen Anfragen in Bund und Ländern zu den Beratungsgremien wurden von den AfD-Fraktionen gestellt. Erst Anfang September reichte die Fraktion im Bundestag wieder eine Anfrage ein, in der es um die nach ihrer Wahrnehmung herausgehobene Stellung des Charité-Virologen Professor Christian Drosten geht.
Demokratisch legitimierte Entscheidungen, so die Schlussfolgerung der Autoren, setzen eine Politikberatung voraus, die „multiple wissenschaftliche Disziplinen und Bevölkerungsperspektiven einschließt“. Dies seien gesellschaftlich entscheidende Faktoren, um gesellschaftlich breit akzeptierte Strategien zur Krisenüberwindung zu entwickeln.
26 %
der Mitglieder in den Corona-Beiräten waren Frauen. In zwei der Beratergremien – in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz – waren gar keine Frauen vertreten.
Unterdessen hat Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) Vorwürfe zurückgewiesen, die Regierung würde sich nicht die gesamte Bandbreite der Positionen von Experten anhören. Braun sagte in einem vorab aufgezeichneten Interview anlässlich der Jahrestagung „House of Pharma & Healthcare“ am Montag, für die Bundesregierung sei insbesondere der Rat von Behörden wie dem Robert Koch-Institut oder der Nationalen Akademie Leopoldina von besonderer Relevanz.
Der Kanzleramtsminister konstatierte, dass selbst vorbereitende Gespräche mit Vertretern aus den Staatskanzleien der Länder im Zuge der Pandemie extrem politisiert worden seien. Es habe kaum noch einen Raum gegeben, in dem Ideen hätten entwickelt und auch wieder verworfen werden können, so Braun.
Impfquoten wie in Bremen wären bundesweit geboten
Von einem Ende der Pandemie könne vermutlich erst dann gesprochen werden, wenn eine Grundimmunität in der Bevölkerung in Deutschland existiere. Wenn Impfquoten wie in Bremen auch bundesweit erreicht würden – in dem kleinesten Bundesland haben am Montag 76 Prozent der Bevölkerung zumindest eine Erstimpfung erhalten – dann würde man „in die Nähe“ einer solchen Grundimmunisierung kommen. Beim aktuellen Stand der Impfungen sei es dagegen wichtig, „hinterher zu bleiben“ mit Instrumenten wie der Quarantäne oder der Kontaktnachverfolgung.
Braun schloss nicht aus, dass es je nach Dynamik der Inzidenzentwicklung im Herbst und Winter zu neuen Beschränkungen für Ungeimpfte kommen könnte. Einen Lockdown, der erneut die Wirtschaft oder Kulturveranstalter hart treffen würde, werde es aber nicht geben, so der Kanzleramtsminister.