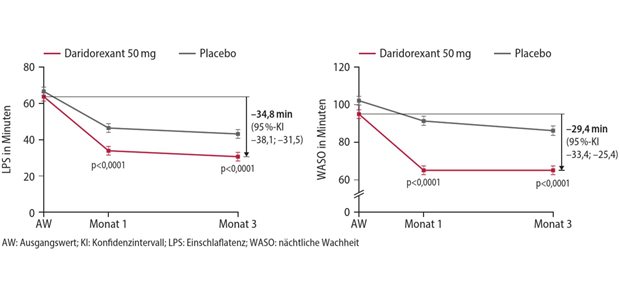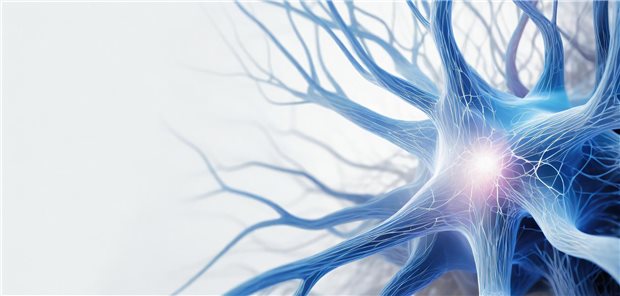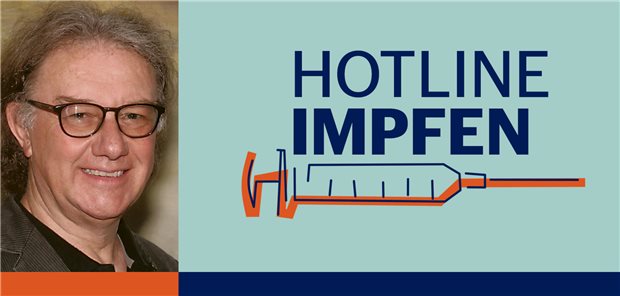Ohne Krisenplan geht es nicht
Die Regeln bei der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung
Vollstationäre Therapie, aber im häuslichen Umfeld? Die Spielregeln für die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung (StäB) sind nicht ohne. Neben einem täglichen Patientenkontakt muss die kurzfristige Intervention in Krisenfällen – und zwar rund um die Uhr – sichergestellt sein.
Veröffentlicht:Neu-Isenburg. Wie lässt sich das soziale Umfeld erhalten und sogar in die Therapie mit einbeziehen? Bei vollstationären psychiatrischen Therapien eine Mammutaufgabe. Erst vor drei Jahren, mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG), hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen für eine neue Form der Versorgung geschaffen: die sogenannte stationsäquivalente psychiatrische Behandlung (StäB).
Sie umfasst eine Krankenhausbehandlung im häuslichen Umfeld durch mobile fachärztlich geleitete multiprofessionelle Behandlungsteams.
Interdisziplinäres Team ist Pflicht
Dass die StäB vielerorts noch im Pilotmodus steckt, liegt zum einen daran, dass die zugehörige Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner – also von Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG), GKV-Spitzenverband und PKV –, in der die Anforderungen an die Leistungserbringung geregelt sind, erst im August 2017 vorlag. Zum anderen an den Netzwerken, die die Kliniken für die StäB vorhalten müssen.
Kern ist nämlich das multiprofessionelle Behandlungsteam, das mindestens aus einem Arzt, einem Mitglied aus der Pflege und einer weiteren, frei wählbaren Berufsgruppe besteht. Die Verantwortung für die Behandlung liegt beim Facharzt. Generell muss eine Klinik, um die StäB erbringen zu können neben Ärzten, Psychologen und Pflegekräften auch Spezialtherapeuten (z.B. Ergotherapeuten, Sozialarbeiter, Kreativtherapeuten) vorhalten.
Wöchentliche Fallbesprechung
Mindestens einmal pro Tag muss ein direkter Patientenkontakt mit einem Teammitglied stattfinden. Für die Abrechnung müssen die Kliniken genau dokumentieren, wenn ein solcher Kontakt aus Gründen, die der Patient zu verantworten hat, nicht zustande gekommen ist. Wobei hier ein Kontaktversuch stattgefunden haben muss.
Außerdem ist eine wöchentliche ärztliche Visite im häuslichen Umfeld des Patienten vorgesehen. Dazu ist es wichtig, dass es im häuslichen Umfeld des Patienten auch einen Rückzugsraum für ungestörte Therapiegespräche gibt.
Hinzu kommen wöchentliche Fallbesprechungen (bei stationsäquivalenter Behandlung an mehr als sechs Tagen in Folge) im multiprofessionellen Team – gegebenenfalls auch unter Einbeziehung weiterer kooperierender Leistungserbringer.
Wichtig, um die vollstationäre Versorgung adäquat nachzubilden, ist die schnelle Erreichbarkeit im Krisenfall. An Werktagen sieht die Vereinbarung daher eine durchgehende Erreichbarkeit des Behandlungsteams zu den üblichen Zeiten des Tagesdienstes der jeweiligen Klinik vor.
Zusätzlich muss die Klinik eine 24-stündige ärztliche Eingriffsmöglichkeit – an sieben Tagen in der Woche – gewährleisten. Dies kann laut DKG über eine allgemeine Rufbereitschaft abgedeckt werden.
„Die Klinik muss ein Konzept haben, wie mit Krisensituationen der stationsäquivalent behandelten Patienten umzugehen ist“, schreibt die DKG in ihren Erläuterungen zur Vereinbarung. Dieses sollte dem Patienten kommuniziert werden. (reh)
Gruppentherapie bleibt möglich
- Die Leistungserbringung bei der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (StäB) liegt primär, aber nicht ausschließlich im häuslichen Umfeld. Der Gesetzgeber wollte, dass Patienten auch weiter an Gruppentherapien im Krankenhaus oder etwa in der Physiotherapie teilnehmen können.
- Auch die Mobilisierung und Befähigung des Patienten, sich aus dem häuslichen Kontext heraus zu bewegen könne schließlich Ziel einer StäB sein, lautete die Begründung des Bundesgesundheitsministeriums damals.