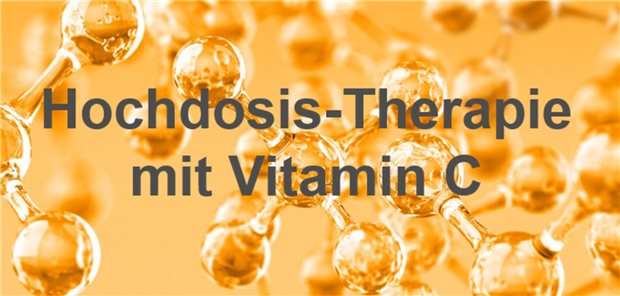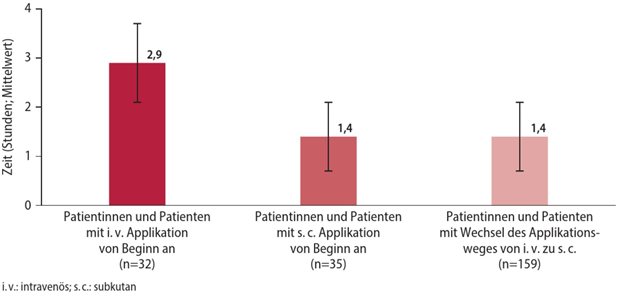COVID-19-Maßnahmen
Experten provozieren mit konstruktiver Corona-Kritik
Sechs Gesundheitsexperten üben in einem Thesenpapier konstruktive Kritik am Vorgehen der Regierung in der Corona-Krise. Darunter: SARS-CoV-2 werde mehr und mehr nosokomial und die Sterblichkeit überschätzt. Und sie haben Gegenvorschläge, um die Maßnahmen besser zu machen.
Veröffentlicht:
Was kann man besser machen und was hätte man schon jetzt besser machen können? Sechs Experten aus Lehre und Gesundheitswesen haben ihre Gedanken zum aktuellen Geschehen rund um die Bekämpfung des Coronavirus in einem Thesenpapier zusammengefasst.
© photoguns / stock.adobe.com
Berlin. Die politischen Entscheidungen zur Pandemie fußen auf einer unzureichenden Datengrundlage; die allgemeinen Präventionsmaßnahmen wie zum Beispiel das Abstandsgebot sind theoretisch schlecht abgesichert und bergen ein riskantes Paradox; das Absagen von Großveranstaltungen, Schul- und Geschäftsschließungen sowie Home Office mögen richtig sein, bergen aber die Gefahr, soziale Konflikte zu verstärken. Sechs Experten aus dem Gesundheitswesen knöpfen sich in einem Thesenpapier die aktuelle Pandemiepolitik vor.
Datenqualität in der Kritik
Erst vor wenigen Tagen hat der Vorsitzende des Sachverständigenrates Professor Ferdinand Gerlach die schlechte Datenqualität kritisiert, aufgrund derer in und von der Politik weitreichende Entscheidungen getroffen werden müssten. Am Montag hat eine Gruppe von sechs Fachleuten in das gleiche Horn gestoßen. Sie stellen drei in den vergangenen Tagen erarbeitete Thesen zur Diskussion, die sich auf die Epidemiologie, auf Präventionsstrategien und gesellschaftliche Aspekte beziehen.
Die Autoren sind keine Unbekannten. Mit Professor Matthias Schrappe und Professor Gerd Glaeske haben das Papier zwei ehemalige „Gesundheitsweise“ gezeichnet, dazu mit Professor Holger Pfaff der ehemalige Vorsitzende des Expertenbeirats des Innovationsfonds. Mit Hedwig François-Kettner ist die ehemalige Pflegedirektorin der Charité und bis vergangenes Jahr Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit an Bord. Der Arzt und Staatsrat der Hamburger Gesundheitsbehörde Dr. Matthias Gruhl und der Jurist und Vorsitzende des BKK-Dachverbandes Franz Knieps vervollständigen die Expertise, die hinter den Thesen steht.
Zweifel an der Maßzahl zur Verdopplung
Die zur Verfügung stehenden epidemiologischen Daten zu Infektionen und Sterblichkeit aufgrund des Ausbruchs von Sars-CoV-2 in Deutschland reichen nicht aus, um die Ausbreitung des neuen Corona-Virus und seine Muster zu beschreiben. Damit können sie nur eingeschränkt zur Absicherung weitreichender Entscheidungen dienen, lautet die erste These.
In vier Unterthesen legen die Autoren dar, dass die Zahl der gemeldeten Infektionen nur geringe Aussagekraft besitze. Grund sei unter anderem die hohe Rate asymptomatischer, aber infektiöser Virusträger von bis zu 80 Prozent aller Infizierten. Daher sei es nicht sinnvoll, eine Verdopplungszeit von Infizierten als Maßzahl zu definieren und davon politische Entscheidungen abhängig zu machen. Zudem treffe die Zahl der gemeldeten Fälle keine Aussage zur Situation am Veröffentlichungstag, sondern beziehe sich auf die Vergangenheit. Jeweils zwei Drittel der Infizierten werde jeweils nicht erfasst. Die Überlegungen zu populationsbezogenen Stichproben müssten intensiviert werden.
Erst am Wochenende war der Zusammenhang zwischen Verdopplungszeit und Exitstrategien in der Politik erneut thematisiert worden. Nachdem in früheren Äußerungen eine Verdopplungszeit von zehn Tagen als möglicher Ausstiegszeitpunkt aus den Beschränkungen des Alltags genannt worden war, war in Bayern nun von 14 Tagen die Rede.
Sterblichkeit überschätzt?
Wenn die Zahl aller Infizierter nicht bekannt sei, seien auch die Aussagen zur Sterblichkeit überschätzt, formulieren die Autoren. Zunehmend werde COVID-19 zur nosokomialen Infektion in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Betreuungseinrichtungen. Dies sei mittlerweile der „dominierende Verbreitungsmodus“. Gleichzeitig nehme der Aufenthalt in Risikogebieten und der individuelle Kontakt als Ansteckungsrisiko ab. Mit der vierten Unterthese nähern sich die Autoren dem Ausbruch als „lokalem Herdgeschehen“ mit nicht vorhersehbarem Muster des Auftretens. COVID-19 verbreite sich nicht homogen in der ganzen Bevölkerung, sondern breite sich über lokal begrenzte Cluster aus. Der Landkreis Heinsberg sowie die Alten- und Pflegeheime in Würzburg und Wolfsburg dienen ihnen dafür als Belege.
These zwei geht auf die Präventionsstrategien ein. „Die allgemeinen Präventionsmaßnahmen, zum Beispiel das social distancing, sind theoretisch schlecht abgesichert, ihre Wirksamkeit ist beschränkt und zudem paradox (je wirksamer, desto größer ist die Gefahr einer „zweiten Welle“) und sie sind hinsichtlich ihrer Kollateralschäden nicht effizient“. Alternativ schlagen die Autoren vor, statt der Schrotschuss-Taktik besser vier Risikogruppen in den Blick zu nehmen. Diese sind: hohes Alter, Multimorbidität, Ärzte und Pflegekräfte sowie lokale Cluster.
Trennung der Behandlungsprozesse
Die Eindämmung der Pandemie ließe sich zudem durch die Trennung der Betreuungs- und Behandlungsprozesse von Infizierten und Nicht-Infizierten sowie das Aufstellen einer Hochrisiko-Task-Force ergänzen, die in den spontan entstehenden Infektionsherden eingesetzt werden könnte.
Mit der dritten These wenden sich die Autoren den gesamtgesellschaftlichen Aspekten des Ausbruchsgeschehens und der Reaktion des Staates darauf zu. „Demokratische Grundsätze und Bürgerrechte dürfen nicht gegen die Gesundheit ausgespielt werden“, heißt es in dem Papier. Die Einbeziehung von Experten und Praxis müsse in einer Breite erfolgen, die einer solchen Entwicklung entgegenwirke.
Eine Kritik an den handelnden Personen im Gesundheitswesen und in der Politik wollen die sechs Fachleute mit ihrem Vorstoß nicht verknüpft wissen. Im Gegenteil: Die hätten in den vergangenen Wochen unter den Bedingungen einer „noch unvollständigeren Information entscheiden müssen als dies heute der Fall sei.
Das Thesenpapier soll am Montag veröffentlicht werden.