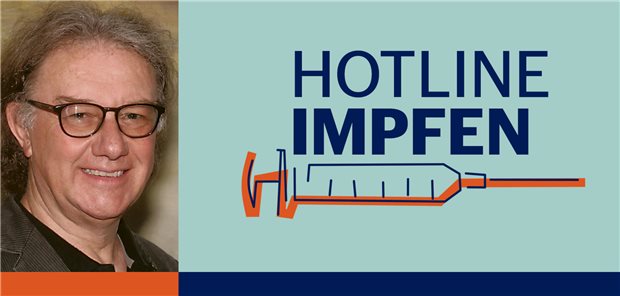Nutzenbewertung
IQWiG prüft die Patientensicht
Das IQWiG stößt eine Methodendebatte an: Künftig könnten auch die Sichtweisen der Patienten auf Therapien in die Nutzenbewertungen einfließen. Warum das alles anderes als einfach ist, hat Institutschef Windeler der "Ärzte Zeitung" erklärt.
Veröffentlicht:
Das IQWiG erwägt, mittelfristig sein Methodenpapier um die Patientenperspektive zu erweitern.
© IQWiG
KÖLN. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) will eine breite Diskussion darüber anstoßen, ob und wie Patientenpräferenzen in die Nutzen- und die Kosten-Nutzen-Bewertung einbezogen werden sollen. In Pilotprojekten hat es zwei Verfahren auf ihre Umsetzbarkeit getestet.
Das IQWiG beziehe die Patientensicht zwar bereits in seine Arbeit ein, sie sei aber kein integraler Bestandteil der Nutzenbewertung, sagt Institutsleiter Professor Jürgen Windeler im Gespräch mit der "Ärzte Zeitung".
"Wir nehmen Patientenmeinungen und -präferenzen ernst, aber es gibt keine evidenzgesicherte, methodische Abbildung im Bewertungsprozess."
Mit dem Analytic Hierarchy Process (AHP) und der Conjoint Analysis (CA) hat das Institut zwei Methoden zur Ermittlung von Patientenpräferenzen unter die Lupe genommen. Das IQWiG veröffentlicht am Freitagein Arbeitspapier zur AHP, das Pendant zur CA soll noch 2013 folgen.
Bei der AHP können die Befragten entscheiden, welcher von zwei Behandlungsendpunkten für sie wichtiger ist und um wie viel. Das IQWiG hat das Verfahren bei der Indikation Depression untersucht.
Ein zentrales Ergebnis: Die Präferenzen von Patienten und Ärzten unterscheiden sich deutlich. So ist für die Patienten das schnelle Ansprechen auf eine Therapie der wichtigste Endpunkt, für Ärzte die Remission.
Sorgfalt und Genauigkeit sind nötig
Bei der CA müssen die Befragten die Kombination mehrerer Kriterien vergleichen und bewerten. Dieses Verfahren prüft das Institut bei der Indikation Hepatitis C.
Das Pilotprojekt habe gezeigt, dass der AHP grundsätzlich geeignet ist, um Patientenpräferenzen zu erfassen, sagt Windeler. "Es lohnt sich, reproduzierende und ergänzende Untersuchungen zu machen."
Ob AHP oder ein anderes Verfahren aber überhaupt in die Bewertungen einfließen soll, müsse nun diskutiert werden. Dabei sollte auch das zweite Arbeitspapier zur CA eine Rolle spielen, meint Dr. Andreas Gerber-Grote, Leiter des Ressorts Gesundheitsökonomie beim IQWiG.
"Wir müssen klären, wo die Vor- und Nachteile der beiden Verfahren liegen." Es seien mehrere Fragen offen, etwa für welche Indikationen sich die Verfahren eignen, oder wie die Patienten rekrutiert werden.
"Wir müssen repräsentative und nachvollziehbare Ergebnisse bekommen. Das ist machbar, aber nicht einfach."
Klar sei, dass eine solche Erweiterung der Bewertungsverfahren mit einem großen Aufwand verbunden sei, betont Windeler.
Die Erhebung von Patientenpräferenzen müsse mit Sorgfalt und Genauigkeit erfolgen: "Ich könnte mir vorstellen, dass wir in zwei, drei Jahren in unseren Verfahren und in unserem Methoden-Papier anders als bisher Patientenpräferenzen berücksichtigen werden."
Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Ein faires Dialogangebot