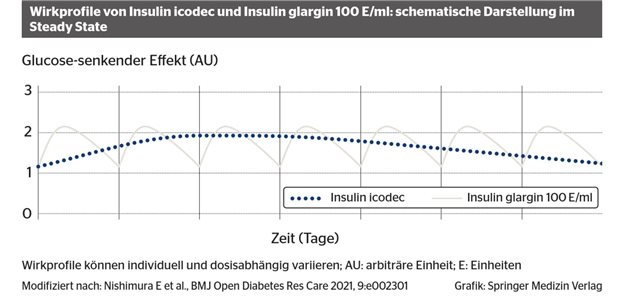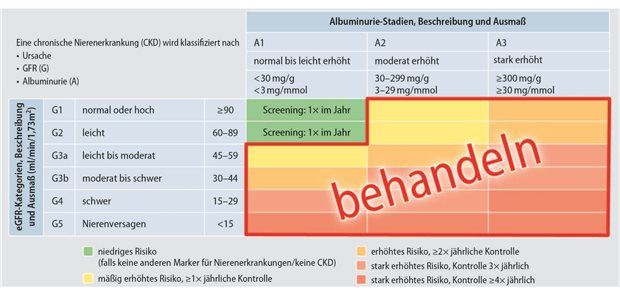Selbstmanagement
Diabetes und Koronarer Herzkrankheit: Gemeinsam gegen den inneren Schweinehund
Ein vom Innovationsfonds gefördertes Projekt soll Typ-2-Diabetiker und KHK-Patienten unterstützen, Manager ihrer Erkrankung zu werden. Im Mittelpunkt des Konzepts stehen Ernährung und Bewegung.
Veröffentlicht:
Unter Anleitung von Sporttherapeuten lernen die Patienten, ihr Bewegungsverhalten zu verändern. (Motiv mit Fotomodellen)
© sabine hürdler/stock.adobe.com
Köln. Das Selbstmanagement der Patienten sollte bei den Disease Management Programmen (DMP) Diabetes Typ 2 und Koronare Herzkrankheit (KHK) stärker in den Fokus rücken, finden Wissenschaftler des Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie (IGKE) der Universitätsklinik Köln. Sie erproben ein Konzept, das bei Erfolg langfristig in die DMP integriert werden könnte.
Über Schulungen gelinge es in den DMP, die Gesundheitskompetenz der Patienten zu stärken, sagt Lisa Giesen, Projektmanagerin beim „Personalisierten Selbstmanagement Unterstützungsprogramm“ (P-SUP), der „Ärzte Zeitung“. „Der Knackpunkt liegt im Bereich der Umsetzung, um eine langfristige Verhaltensänderung zu erreichen.“
Sporttreffen einmal die Woche
Hier setzt P-SUP an. Das Programm basiert auf der gezielten Betreuung von Diabetes- und KHK-Patienten in kleinen Gruppen, um unter Anleitung von Sporttherapeuten und Ernährungswissenschaftlern das Ernährungs- und Bewegungsverhalten nachhaltig zu verändern. Kernelemente sind wöchentliche gemeinschaftliche Sporttreffen und monatliche Gesprächsrunden. Ziel ist es, die Lebensqualität, das Wohlbefinden und die Versorgung der Patienten zu verbessern sowie die Zahl der Folgekrankheiten, der Komplikationen und der Klinikaufenthalte zu reduzieren.
P-SUP wird über vier Jahre mit 8,6 Millionen Euro durch den Innovationsfonds gefördert. Das IGKE ist Konsortialführer. Partner sind die Uniklinik Köln, die Deutsche Sporthochschule Köln, das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland, die Universität Bamberg, die Institute für Allgemeinmedizin an den Universitäten Aachen, Bonn, Düsseldorf und Duisburg-Essen, die Medizinische Universität Wien, die AOK Rheinland/Hamburg und die Barmer. Die Auswertung des Projekts beginnt im Januar 2023.
135 Arztpraxen machen mit
Teilnehmen können Patienten, die in eines der beiden DMP eingeschrieben sind. Rekrutiert werden die Patienten über die Hausärzte. Insgesamt 135 Praxen machen bereits mit. „Wir haben noch Potenzial nach oben“, betont Giesen. Beteiligen können sich Hausärzte aus Nordrhein-Westfalen, Schwerpunkt ist Nordrhein.
Derzeit sind rund 300 Patienten eingeschrieben – angestrebt werden 1000 bis 1200. Das Projekt war zunächst beschränkt auf Versicherte der AOK Rheinland/Hamburg und der Barmer, ist jetzt aber geöffnet worden. Von den Teilnehmern kommen rund 80 Prozent aus dem DMP Diabetes, 20 Prozent aus dem DMP KHK. „Rund 15 Prozent haben beide Erkrankungen“, berichtet Giesen.
Wegen der Coronavirus-Pandemie konnten die Gruppen statt im September 2020 erst im Februar 2021 die Arbeit aufnehmen – und dies auch nur in digitaler Form. Das soll sich ändern, wenn die Bedingungen es wieder zulassen. Im Moment sind sechs Gruppen mit vier bis sechs Teilnehmern aktiv. Die Patienten sind im Durchschnitt 70 bis 75 Jahre alt. Angelegt ist das Programm auf 18 Monate. Langfristig sollen es 20 bis 25 Gruppen mit bis zu zehn Teilnehmern werden.
Patienten leiten die Gruppen
Geleitet werden die Gruppen von speziell geschulten Diabetes- oder KHK-Patienten. Die Hoffnung: Da diese Menschen genau wissen, wovon sie reden, fällt es ihnen leichter, die Teilnehmer zu überzeugen. „Wir wollten ein niederschwelliges Konzept“, sagt Projektleiter Dr. Marcus Redaèlli. Das Programm ist unter Beteiligung von Patienten entwickelt worden. So konnten die Wissenschaftler herausfinden, welche Angebote die Patienten wünschen und welche Informationen sie in welcher Form aufnehmen können. „Das ist wichtig, um die Menschen zu motivieren, Manager ihrer Erkrankung zu werden“, betont Redaèlli.
Der Ansatz komme bei den Hausärzten gut an. Das gilt nach seinen Angaben auch für das Telefon-Coaching durch Mitarbeiter der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Kölner Uniklinik. „Es ist für Patienten gedacht, die erhöhten Unterstützungsbedarf haben.“ Einmal im Quartal erhalten die Teilnehmer über die Hausärzte einen Feedbackbericht. In verständlicher Sprache erfahren sie, wie sich krankheitsrelevante Parameter entwickelt haben. Eine Kopie bleibt beim Arzt. „Die Kollegen erhalten über die Berichte einen schnellen Überblick über die Veränderungen bei den Patienten“, sagt Redaèlli.