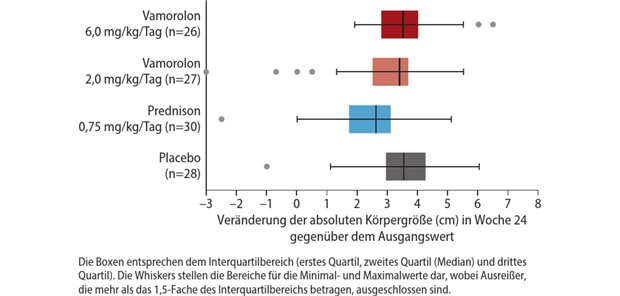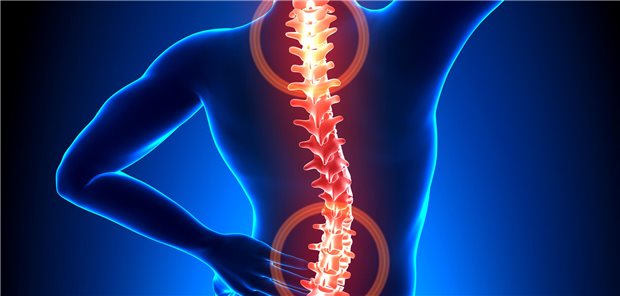Studie
Mindestmengen können Frühchen das Leben retten
Würde die Mindestmenge für die Versorgung von sehr frühgeborenen Kindern von derzeit 14 auf 50 bis 60 hochgesetzt werden, könnten bis zu 40 Todesfälle pro Jahr vermieden werden, besagt eine Studie.
Veröffentlicht:
Frühgeborenes Baby: Eine Studie zeigt, höhere Mindestmengen in Perinatalzentren der Maximalversorgung könnten wohl einige Leben retten.
© Jason / stock.adobe.com
Köln. Extrem kleine Frühgeborene haben offenbar deutlich bessere Überlebenschancen, wenn sie in einem Perinatalzentrum zur Welt kommen, dass jährlich mindestens 50 bis 60 dieser Kinder versorgt. Darauf lassen Ergebnisse einer groß angelegten Studie schließen, die in der Fachzeitschrift „Geburtshilfe und Neonatologie“ erscheint (Heller G et al. (2020): Z Geburtsh Neonatol 2020; 224: 1–8. DOI: 10.1055/a-1259-2689). Allerdings erreicht in Deutschland nur jedes vierte Level-I-Perinatalzentrum diese Zahlen. Die Studienautoren empfehlen deshalb nach Angaben des Science Media Centers (SMC), die Mindestmenge für Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm schrittweise anzuheben.
Eine Mindestmenge von 50 bis 60 Frühgeborenen je Perinatalzentrum der maximalen Versorgungsstufe würde laut SMC bedeuten, dass die Anzahl der entsprechenden Zentren in Deutschland von derzeit 163 auf circa 40 sinken würde. Dadurch ließen sich nach Auffassung der Studienautoren 25 bis 40 Todesfälle pro Jahr vermeiden, heißt es.
Kliniken mit Klagen gegen Mindestmengen erfolgreich
Für extrem unreife Frühgeborene gilt seit 2010 eine Mindestmenge von 14 Fällen pro Jahr und Klinik. Als der Gemeinsame Bundesausschuss ebenfalls 2010 die Mindestmenge auf 30 hochsetzte, haben mehrere Kliniken dagegen vor dem Bundessozialgericht geklagt – mit Erfolg. Die Richter waren der Auffassung, dass es keine ausreichenden wissenschaftliche Grundlage für eine solche Erhöhung gebe.Das könnte sich nun ändern, denn die Studienautoren haben die Behandlungsergebnisse aller Frühgeborenen aus sämtlichen deutschen Perinatalzentren von 2010 bis 2018 untersucht. So wollten sie die optimale Mindestmenge herausfiltern.
Studie baut Handlungsdruck auf
„Die Analyse beruht auf den tatsächlich gemeldeten Ergebnisdaten aller deutscher Perinatalzentren und ist damit für Deutschland hochgradig repräsentativ“, kommentiert der Leiter der Abteilung für Neonatologie am Uniklinikum Leipzig, Professor Ulrich Thome, die Studienergebnisse. Glücklicherweise sei die Zahl der berechneten vermeidbaren Todesfälle relativ niedrig, für einen Handlungsdruck reichten sie aber aus.Die Todesfälle seien zudem nur die Spitze des Eisbergs. Denn dem Sterben gingen meist konkrete Gesundheitsschäden voraus und es gebe natürlich immer Kinder, die Gesundheitsschäden haben, aber mit ihnen überlebten. Es sei anzunehmen – und durch einige ausländische Gesundheitssysteme auch belegt – dass dort, wo das Sterberisiko erhöht sei, auch die Gefahr Dauerschäden oder Behinderungen zu erleiden, steige. Demnach wäre auch ein Teil der Behinderungen, mit denen manche Kinder zu kämpfen hätten, vermeidbar, wenn alle sehr kleinen Frühgeborenen in Perinatalzentren mit mindestens 50 bis 60 solcher Patienten pro Jahr zur Welt kämen.
Anhebung nur schrittweise möglich
Thome spricht sich für eine schrittweise Anhebung der Mindestmenge aus, „da die Kapazitäten der verbleibenden Perinatalzentren teilweise angehoben werden müssten, um die Gesamtzahl der Patienten zu bewältigen“.Statt die in Deutschland sehr große Zahl kleiner und ineffizienter Perinatalzentren zu erhalten, sei es sinnvoll, das Geld lieber für flankierende Maßnahmen für Familien auszugeben, deren Kind in einem weiter entfernteren Krankenhaus liege. Thome denkt dabei an von den Krankenkassen finanzierte Unterbringungsmöglichkeiten oder die Finanzierung von Haushaltshilfen, zur Betreuung von Geschwisterkindern.
Effekt eigentlich noch ausgeprägter
Eigentlich sei der Behandlungsvorteil in einem hochspezialisierten Zentrum noch ausgeprägter, als es die analysierten Daten nahelegten, sagt Professor Christoph Bührer, Direktor der Klinik für Neonatologie an der Berliner Charité. Denn die Daten seien fall- und nicht personenbasiert analysiert worden. Bei jeder Verlegung von einem Krankenhaus in ein anderes entstehe in den Daten ein neuer Fall. Die Fälle würden aber nicht zusammengeführt. Wenn also ein Kind sterbe, werde der Todesfall der Klinik zugerechnet, die das Kind zuletzt behandelt habe – „auch wenn oft die Ursache des Todes in Umständen zu suchen ist, die im vorher behandelnden Krankenhaus aufgetreten sind“, sagt Bührer. Gerade bei Komplikationen würden aber Frühgeborene aus Kliniken mit geringerer Fallzahl in spezialisierte Zentren verlegt und stürben möglicherweise dort. „Bei einer personenbasierten Betrachtung wäre der errechnete Behandlungsvorteil in großen Zentren vermutlich ausgeprägter gewesen, ohne dass sich etwas an der Grundaussage geändert hätte“, so Bührer.Halbierung der Zentren wäre schon ein großer Schritt
Bührer kann sich wie Thome nur eine schrittweise Anhebung der Mindestmenge vorstellen, weil auch die Personalkapazitäten in die größeren Kliniken mitwandern müssten, sagt er.Eine drastische Reduzierung der Level-I-Perinatalzentren auf ein Viertel des jetzigen Bestandes hält Bührer schon aus politischen Gründen für nicht schnell und auch nicht überall umsetzbar. „Aber wenn es gelänge, ihre Anzahl zu halbieren, wäre das ein großer Schritt nach vorn“, sagt der Neonatologe. In Schweden sei die Behandlung sehr unreifer Frühgeborener auf acht Kliniken konzentriert worden, berichtet Bührer, und die Sterblichkeit sei dort geringer als in Deutschland.
Diese Umstrukturierung sei dort gelungen, obwohl die Bevölkerungsdichte Schwedens nur zehn Prozent der deutschen betrage und die Fläche die Deutschlands um 25 Prozent übersteige. „Hätten wir schwedische Verhältnisse, wäre die Anzahl der Perinatalzentren der maximalen Versorgungsstufe in Deutschland vergleichbar mit der Anzahl der Ikea-Einrichtungshäuser“, so Bührer.
Kaum zu verstehen sei auch, dass die meisten Frühgeborenen deutlich mehr wiegen würden als 1250 Gramm und so in einem Level-II-Perinatalzentrum behandelt werden könnten. Zur Zeit gebe es in Deutschland aber mehr als dreimal so viele Level-I-Perinatalzentren (Maximalversorgung) wie Level-II-Zentren (Schwerpunktversorgung). „Das Verhältnis sollte aber genau andersherum sein“, kritisiert er.