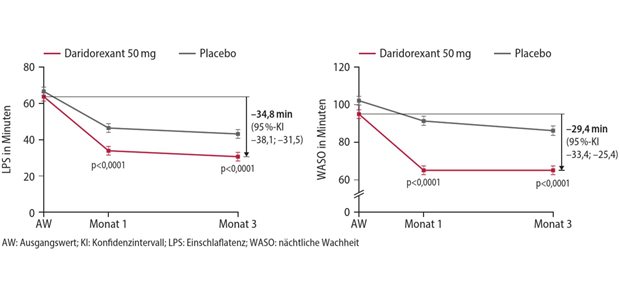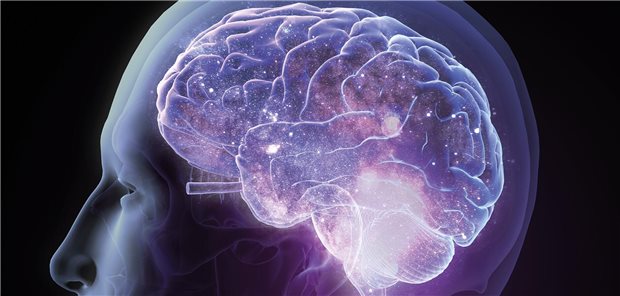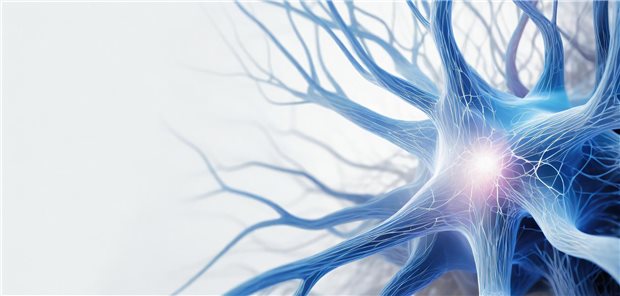Supervision an der Kaffeetasse
Wie die Charité ihren COVID-Kräften Beistand leistet
Pfleger und Ärzte der Berliner Charité sind durch Corona auch psychisch stark belastet. Wie die Klinik versucht, ihre Beschäftigten zu unterstützen, berichtet Matthias Rose, Leiter der Klinik für Psychosomatik, im Interview.
Veröffentlicht:
Die Coronakrise hat den Pflegekräften an der Charité zugesetzt. Um sie zu unterstützen, gehören inzwischen zehn Psychologen zum Team. Sorgen können dadurch unkompliziert in den Pausen angesprochen werden.
© Alexander Raths / stock.adobe.com
Berlin. Seit fast zwei Jahren sind die Pfleger und Ärzte in Krankenhäusern im Dauerstress. Kürzlich mahnte die OECD, die psychischen Belastungen, unter denen die Klinikmitarbeiter wegen Covid-19 leiden, nicht zu vergessen. Wie die Berliner Charité versucht zu helfen, erklärt Professor Matthias Rose, Leiter der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik.
Ärzte Zeitung: Herr Professor Rose, schon während der ersten Welle wurde auf die psychischen Belastungen hingewiesen, denen Pfleger und Ärzte durch die stationäre Versorgung von COVID-Patienten ausgesetzt waren. Ist diese Belastung jetzt angesichts der sich mächtig auftürmenden vierten Welle noch größer geworden?
Matthias Rose: Den Anteil derjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die deswegen unter starker psychischer Belastung stehen, ist sicher höher geworden im Laufe der Pandemie. Aber die Gründe und Begleitumstände haben sich während der vergangenen Monate etwas geändert. Während der ersten Welle gab es für Pfleger und Ärzte noch das hohe Risiko, sich selbst zu infizieren und ernsthaft krank zu werden. Das ist jetzt durch die Impfung weniger gegeben.
Man hat in der ersten Welle die Situation zwar als ernsthafte Gefahr eingestuft, aber auch als Herausforderung begriffen, die gemeistert werden kann. Vieles wurde unbürokratisch gelöst. Es gab gesellschaftliche Solidarität und Anerkennung für die Arbeit der Pfleger und Ärzte. Im vergangenen Winter wusste man, was auf einen zukommt, man konnte damit schon umgehen. Jetzt ist unter den Beschäftigten der Charité eine gewisse Erschöpfung da. Wir behandeln ja nicht nur COVID-Patienten, sondern haben auch versucht, die Operationen und Behandlungen nachzuholen, die zwischenzeitlich liegen geblieben sind. Dadurch gab es praktisch keine Erholungsphasen. Schwierig ist jetzt die Wahrnehmung, dass die politische Akzeptanz der Maßnahmen priorisiert wird vor der Verhinderung der Überlastung des Gesundheitssystems.
Wer leidet besonders unter psychischen Belastungen?
Überlastungen entstehen durch Bedrohungssituationen. Deshalb entsteht gerade da, wo medizinisches Personal von Routinebereichen in andere Aufgabengebiete versetzt wird, also wie momentan von der Normal- auf die Intensivstationen, das Gefühl der Überlastung. Wenn man aus seiner Umgebung, aus seinem Team herausgerissen wird, führt das zu Verunsicherung. Das gleiche gilt, wenn neue Teams zusammengestellt werden, die nicht so routiniert sind: Auch das ist sehr anstrengend. In den Bereichen der Charité, die nicht unmittelbar mit der Versorgung von COVID-Patienten zu tun haben, gibt es natürlich auch psychische Belastungen, die weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Auch hier können die Pflegekräfte nicht mehr ihren genuinen Aufgaben wie gewohnt nachgehen, weil Kollegen auf die Coronastationen abgezogen wurden.
Wie äußert sich bei den Mitarbeitern die psychische Belastung?
In körperlicher Erschöpfung, Frustration und Müdigkeit. Da tut natürlich die immer noch zu niedrige Impfquote ihr übriges.
Wie wird den Betroffenen geholfen?

Professor Matthias Rose, Leiter der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik an der Charité.
© W. Peitz / Charité
Das Problem ist: Wenn Sie warten, bis die Leute sich melden, weil sie nicht mehr können, ist es schon zu spät. Wir haben schon vor der Pandemie begonnen, Hilfen anzubieten – als ob wir es geahnt hätten. Wir haben besonders die Intensivstationen in den Blick genommen, weil es hier – auch unabhängig von Covid – besondere psychosoziale Anforderungen an die Betreuung von Erkrankten und Angehörigen gibt. Da gibt es beispielsweise Patienten, sie sich Sorgen machen, wie es nach dem Krankenhausaufenthalt für sie weitergeht, oder die Angst haben, beatmet zu werden. Und da gibt es natürlich Angehörige, um die man sich kümmern müsste. Dafür fehlte aber oft die Zeit.
Auf den Intensivstationen wurden deshalb Psychologinnen und Psychologen in die Teams integriert, die die Betreuung der Patienten und Angehörigen übernehmen. Auf den COVID-Stationen haben wir derzeit zehn Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Das hat sich absolut ausgezahlt. Denn der Vorteil ist: Auch Pfleger und Ärzte kommen natürlich mit den Psychologen nebenbei in den Pausen ins Gespräch. Das ist gewissermaßen Supervision an der Kaffeetasse. So schwindet die Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen. Ärzte und Pfleger können sich so mal entlasten und ihre Sorgen loswerden. Desweiteren gibt es auch Einzelfallbesprechungen für Mitarbeiter sowie therapeutische Unterstützung und ein psychosoziales Netzwerk, das die gesamte Charité umfasst.
Die psychosoziale Betreuung hat sich so gut bewährt, dass sie auf jeden Fall auch nach der Pandemie weiterlaufen wird. Sie ist eine unmittelbare Hilfe, die hoch geschätzt wird, und ein wichtiges Signal des Charité-Vorstands. Man muss auch bedenken: Wenn Ärzte und vor allem Pfleger den Eindruck haben, dass Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch psychosozial so gut wie möglich versorgt werden, dann geht es auch ihnen ein Stück besser.
Wie gehen Sie vor, wenn ein Pfleger oder Arzt zu Ihnen kommt?
Es geht darum, über die Probleme zu sprechen. Ein Arzt sagte zu mir einmal, dass er gar nicht wisse, wie er dauerhaft mit der Situation auf der Intensivstation zurechtkommen solle. Wichtig ist, dass man seinen Blick nicht nur bis kurz vor seine Fußspitze richtet, wo alles bedrohlich wirkt, sondern auch über das Pandemieende hinaus sieht. Man muss den Menschen klarmachen, dass das ein Langstreckenlauf ist, dass sie nicht die Welt retten müssen, sondern ihren Job nur so gut machen müssen, wie es eben geht. Sie müssen die Grenze akzeptieren, dass man manche Menschen nicht retten können wird. Man kann Zweifel ausräumen, ob man der neuen Aufgabe auf der Intensivstation gewachsen ist, oder Sorgen, dass man die Großmutter anstecken könnte, relativieren. Nach den Gesprächen ist der Kopf meist klarer.
Aber trotzdem haben wir natürlich noch große Herausforderungen an der Peripherie zu lösen, nämlich auf den Stationen, die mit COVID nicht direkt etwas zu tun haben. Hier müssen wenige Pflegekräfte die Versorgung aufrechterhalten, weil ihre Kolleginnen und Kollegen auf die COVID-Stationen abgezogen wurden. Sie haben zwar die Möglichkeit, das psychosoziale Netzwerk der Charité in Anspruch zu nehmen. Aber es ist ein bisschen schwieriger, mit diesen niedrigschwellig in Kontakt zu kommen, als bei den Kollegen auf den Intensivstationen bei denen eine Psychologin Teil des Teams ist.