Transplantationen
Aktuelle Organspende-Debatte geht am Problem vorbei
Jens Spahn will sich am Organspende-Weltmeister Spanien orintieren und die Widerspruchslösung einführen. Der Erfolg der Iberer hängt mit besonderen Faktoren zusammen.
Veröffentlicht: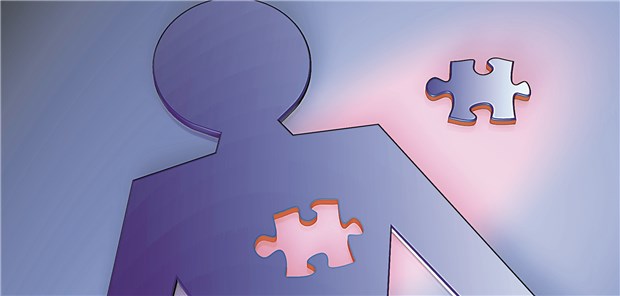
Zu wenig Organspender? Das liegt vor allem auch am Meldewesen der Kliniken.
© Reiner Kaltenegger / mauritius images
Nachdem das W-Wort einmal ins Land entlassen war, kam es, wie es kommen musste. Seither dreht sich die Diskussion darüber, wie sich die Organspenden in Deutschland vermehren lassen, nur noch um diesen einen Begriff: Widerspruchslösung. Einfach oder doppelt. Geboten oder verboten. Richtig oder falsch. Das ist schade.
Dem Gesundheitsminister ist zugutezuhalten, dass er das Problem nicht nur erkannt hat, sondern ihm auch den gebührenden Platz einräumt. Jens Spahn (CDU) hat sogar kürzlich den "Entwurf eines Gesetzes für bessere Zusammenarbeit und bessere Strukturen bei der Organspende" vorgelegt. Damit legte er den Finger in die Wunde, denn die klafft ebendort: bei der Zusammenarbeit und den Strukturen. Doch dann sprach er das W-Wort.
Oft wird an dieser Stelle der Debatte auf Spanien verwiesen. Schließlich wollen alle zu den Spaniern aufschließen, den Weltmeistern bei den Organspendezahlen. Und praktizieren nicht die Spanier diese Widerspruchslösung, wonach jeder, der nicht zu Lebzeiten widerspricht, in die Entnahme seiner Organe post mortem einwilligt?
Selbstverständlich wäre es zu begrüßen, Organspenden so erfolgreich zu sammeln wie die Spanier. Es fragt sich aber, ob die Einführung einer Widerspruchslösung dieses Ziel wesentlich fördert. Zur Erinnerung: Spanien hat die Widerspruchslösung bereits Ende der 1970er-Jahre eingeführt.
In den folgenden zehn Jahren führte das aber nicht dazu, dass die Spenderzahlen nennenswert stiegen. Noch im Jahr 1989 lag die Spenderquote bei 14 je Million Einwohner. Der spanische Erfolg, der sich mittlerweile in einer Spenderquote von knapp 47 je Million Einwohner niederschlägt, muss daher weit mehr und wichtigere Ursachen haben als die Widerspruchslösung. Das zeigt sich auch darin, dass mittlerweile die meisten europäischen Länder eine Widerspruchslösung eingeführt haben. Dennoch kommt mit Ausnahme Kroatiens kein Land in die Nähe der spanischen Zahlen.
Bessere Organisation und Kommunikation nötig
Der Aufstieg Spaniens zur Transplantationsnation Nummer eins begann 1989. Damals wurde die Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ins Werk gesetzt. Sie etablierte das "Spanische Modell", dessen Schlüsselbegriff Organisation lautet. Dazu gehört eine dreistufige Transplantationskoordination auf Klinik-, regionaler und nationaler Ebene. Zu den strukturellen Maßnahmen zählt die kontinuierliche Prüfung der Fälle von Hirntoten auf Intensivstationen. Und es gibt rechtliche Regeln, zu denen die Widerspruchsregelung gehört.
Mit besserer Organisation und Kommunikation ließen sich die Spenderzahlen auch hierzulande erhöhen, Widerspruchslösung hin, Zustimmungs- oder Entscheidungslösung her. Erst im Juli sind die Ergebnisse einer bundesweiten Analyse aller vollstationären Behandlungsfälle erschienen ("Ärzte Zeitung" vom 9. Juli, S. 6). Hiernach ist etwa die Zahl der möglichen Organspender in Deutschland zwischen 2010 und 2015 um 13,9 Prozent gestiegen, von 23.937 auf 27.258. Im gleichen Zeitraum aber sank die Zahl der realisierten Organspenden von 1296 auf 877, also um fast ein Drittel.
Das Fazit der Forscher um Dr. Kevin Schulte vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel ist eindeutig: "Der Rückgang der postmortalen Organspenden ist mit einem Erkennungs- und Meldedefizit der Entnahmekrankenhäuser assoziiert. Gelingt es, diesen Prozess organisatorisch und politisch zu stärken, könnte die Zahl der gespendeten Organe erheblich gesteigert werden." Eine veränderte Einstellung der Betroffenen oder ihrer Angehörigen habe demgegenüber nur einen geringfügigen Einfluss.
Nur ein Gesetz allein führt nicht zu mehr Spenden
Wäre es gelungen, die Realisationsquote von 3,2 auf 10,2 Prozent zu steigern – eine Quote, die laut einer Analyse der Deutschen Stiftung Organtransplantation erreichbar wäre –, hätte allein das schon bewirkt, dass die Spendenquote 33,8 je Million Einwohner betragen hätte. Sie hätte damit rund dreimal so hoch gelegen wie für 2015 vermerkt.
Was die Widerspruchslösung betrifft, sollte man sich vielleicht noch einmal der Worte von Rafael Matesanz erinnern. Dieser ist gewissermaßen der Schöpfer des spanischen Modells und war bis zum vergangenen Jahr Direktor der ONT.
Schon vor Jahren riet er im Gespräch mit der Nachrichtenplattform "swissinfo" dazu, der Widerspruchslösung nur dort zu vertrauen, wo ein allgemeiner Konsens darüber herrsche. Sonst könne es sein, dass man das Gegenteil von dem bewirke, was man beabsichtige.
Wirklich bedauerlich also, dass die deutsche Diskussion sich derzeit so sehr um Widerspruch oder Zustimmung dreht. Der Streit darüber, wie Strukturen und Kommunikation zu verbessern wären, kommt dadurch in der Öffentlichkeit zu kurz. Dabei wären organisatorische Veränderungen dringend geboten. Matesanz hat das schon früh erkannt: "Es gibt keinen einzigen Fall auf der Welt, wo die Zahl der Spender allein durch eine Gesetzesänderung zugenommen hat."






