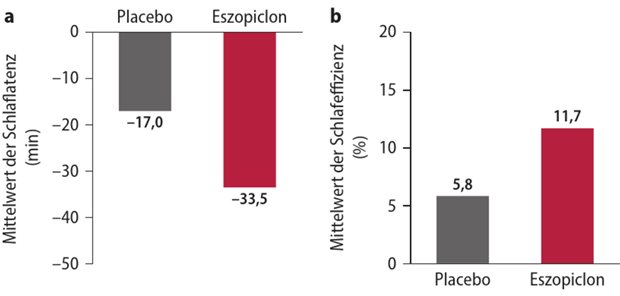EvidenzUpdate-Podcast
Prävention und der Koalitionsvertrag – Ignoranz oder Feigheit?
In Bälde soll es eine neue Bundesregierung geben – und mit ihr einen Koalitionsvertrag. Die ersten Pläne fürs Gesundheitswesen nehmen wir in dieser Episode vom EvidenzUpdate-Podcast auseinander. Wir finden vor allem: ein präkoalitionäres Patchwork.
Veröffentlicht:
In dieser Episode vom EvidenzUpdate-Podcast nehmen wir die gesundheitspolitischen Pläne der mutmaßlich künftigen Koalition von CDU/CSU und SPD unter die Lupe – oder besser gesagt: das bunte Sammelsurium aus Ideen und Maßnahmen, die bislang ohne kohärentes Gesamtkonzept daherkommen. Was ist gut? Was ist wohlmeinend, aber unausgegoren? Und was eher Stoff für eine Soundmaschine? 🎛️
🩺 Vorbeugemedizin – oder: Gießkanne mit Bias
„Es ist kein Gesamtkonzept vorhanden, es ist ein Sammelsurium aus Einzelaspekten.“ – Martin Scherer
Die Koalition will Prävention stärken, etwa durch ausgeweitete U-Untersuchungen und Einladungswesen – doch Scherer mahnt: Ohne Evidenz wird‘s zum Healthy-Volunteer-Bias. Und Pubmed als Recherche-Instrument? Hat zwar nichts mit der NoKo-GroKo zu tun, wackelt womöglich aber auch bald. 🧪
🧠 Psychische Gesundheit & Einsamkeit. Einsamkeit hat krankmachendes Potenzial – erste Studien zeigen positive Effekte durch Besuchsdienste oder kreative Gruppenangebote. Aber:
„Es gibt erste Lichtblicke, aber noch keinen belastbaren Standard.“
🧑⚕️ Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD): Lichtblick mit Professuren. Der ÖGD wird akademisiert und bleibt wichtig – da sind sich alle einig. Immerhin.
📊 Daten, Daten, Daten! Scherer fordert besseren Zugang zu Routinedaten:
„Es gibt sehr fähige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch viel mehr machen könnten, wenn der Zugang besser wäre.“
🧒 Kinder- und Jugendgesundheit: Gute Idee, wacklige Basis. Ein Pakt für Kindergesundheit soll kommen. Klingt gut – wäre da nicht das Bildungssystem, das oft schon an den Basics scheitert.
„Es mutet ein bisschen so an, als ob jemand zerrissene Klamotten anhat und sich dann eine schöne Mütze aufsetzt.“
🍭 Sucht & Zucker – Aufklärung reicht nicht. Medien-, Nikotin- und Alkoholsucht sollen angegangen werden. Aber Zuckersteuer? Fehlanzeige.
„Entweder scheitert die Verhältnisprävention an der Feigheit der Politik oder an ihrer Ignoranz.“
🫀 Organspende: Spanien kann‘s besser. Opt-out funktioniert – Spanien zeigt‘s, nur gehören zum Erfolg dort noch viele andere Dinge dazu. Deutschland diskutiert erst einmal weiter.
„Wir sind gut darin, die Dinge kompliziert zu machen.“
🚑 Primärärztliche Steuerung: Endlich? Ein verbindliches Hausarztsystem soll kommen – zumindest als Ziel. Doch mit Ausnahmen und Parallelregelungen (z. B. Termingarantie mit Krankenhauslösung) droht das nächste Chaos.
„Wir wollen doch eigentlich Ordnung bringen ins System.“
📉 Fazit von Scherer:
„Das, was wir an Unterversorgung haben, ist die Kehrseite der Überversorgung an falscher Stelle.“
🧩 Alles in allem: Viele kleine Ideen – aber kein großes Bild. Oder wie Scherer es nennt: ein „Patchwork-Themengebilde“. Für eine echte Reform braucht es mehr Mut, mehr Struktur und vor allem ein Zielbild. 🧭 (Dauer: 39:29 Minuten)
Anregungen? Kritik? Wünsche?
Schreiben Sie uns: evidenzupdate@springer.com
Shownotes
-
Koalitionspläne: So wollen Union und SPD das Gesundheitswesen reformieren. ÄrzteZeitung. 2025. www.aerztezeitung.de (accessed 8 Apr 2025).
-
Mallapaty S. ‚Omg, did PubMed go dark?‘ Blackout stokes fears about database’s future. Naturecom Published Online First: 4 March 2025. doi:10.1038/d41586-025-00674-3
-
Butz S, Hügel MG, Kahrass H, et al. Soziale Isolation und Einsamkeit im Alter. Welche Maßnahmen können einer sozialen Isolation vorbeugen oder entgegenwirken? Health Technology Assessment im Auftrag des IQWiG. 2022. www.iqwig.de (accessed 8 Apr 2025).
-
Scherer M, Nößler D. „EvidenzUpdate“-Podcast: Was haben Leitlinien eigentlich mit Armut und Gerechtigkeit zu tun? ÄrzteZeitung. 2022. www.aerztezeitung.de (accessed 8 Apr 2025).
-
Social Prescribing EU: Charité – Universitätsmedizin Berlin. Institut für Allgemeinmedizin - Charité – Universitätsmedizin Berlin. 2025. allgemeinmedizin.charite.de (accessed 8 Apr 2025).
-
Positionspapier der DEGAM: Lessons learned aus der Pandemie. 2023. www.degam.de (accessed 8 Apr 2025).
-
NDR Story: Brennpunkt Schule: Tagebuch einer Lehrerin. ARD Mediathek. 2025. www.ardmediathek.de (accessed 8 Apr 2025).
-
Kolbe J, Simonsen S, Ways M, et al. BILD-Herzgipfel: Vorsorge kann viele Herzkrankheiten verhindern | Leben & Wissen. BILD. 2025. www.bild.de (accessed 8 Apr 2025).
Transkript
Nößler: Schwarz und rot, groß und klein, egal wie man sie nennt, die Republik soll in Bälde eine neue Regierungskoalition bekommen. Und Ideen für das Gesundheitsweisen haben die Koalitionäre in spe schon zur Genüge. Manche schauen wir uns heute mal an. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des EvidenzUpdate-Podcast. Wir, das sind ...
Scherer: Martin Scherer.
Nößler: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DEGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Denis Nößler. Moin, Herr Scherer!
Scherer: Hallo Herr Nößler! Guten Morgen!
Nößler: Guten Morgen! Wie geht es Ihnen?
Scherer: Danke, sehr gut. Es scheint hier die Sonne. Das Wochenende war auch sehr sonnig. Hier im Norden dauert es ja noch ein bisschen mit dem Frühling. Also kalendarisch ist er schon da, aber wenn man mal so in Köln war beispielsweise, die letzte Woche hatten wir da Spitzentreffen Allgemeinmedizin, da ist alles grün, da ist alles warm. Hier in Süd-Schleswig-Holstein, da muss man dem Ganzen noch so ein bisschen Zeit geben.
Nößler: Aber hell ist es. Lange, lange ist es hell mittlerweile.
Scherer: Das passt ja genau dazu, dass wir erst mal Licht in bestimmte Bereiche bringen.
Nößler: So ist es. Wir haben uns für diese Episode vielleicht wieder eine knackige – na ja, wie haben wir es im Vorgespräch genannt? – so ein präkoalitionäres Staccato vorgenommen. Manche haben es mitbekommen. Es sind aus den Koalitionsverhandlungen erste Arbeitspapiere durchgesickert. Wir reden hier im Gesundheitswesen von der Arbeitsgruppe 6, die haben so ein 11-Seiten-Dokument „vorgelegt“, das ist alles veröffentlicht. Kurzer Disclaimer dazu: Wir haben heute Montag, den 7. April. Es soll wohl jetzt die Woche der Schlussverhandlungen sein. Und es kann natürlich alles sein, dass Dinge, die wir jetzt besprechen, am Ende es nicht in ein Koalitionsvertrag schaffen. Das werden wir uns dann anschauen. Wir besprechen das, was die Arbeitsgruppe bis dato zusammengetragen hat. Und da haben Sie sich ein paar Wunschstichworte rausgepickt, über die wir heute mal sprechen wollen. Und die hoppeln wir jetzt mal durch. Und dann versuchen wir mal eine Klammer zu finden. Und am Ende schauen wir mal, was uns überrascht oder was nicht. Das Erste, was Sie gefunden haben, ist der wunderschöne Begriff Vorbeugemedizin, Martin Scherer, den, glaube ich, unser Noch-Gesundheitsminister geprägt hat.
Scherer: Es mutet so ein bisschen an wie das Gesunde-Herz-Gesetz light. Die Koalition will Krankheitsvermeidung und Gesundheitsförderung priorisieren. Geplant ist die bestehenden U-Untersuchungen, also Vorsorgechecks auch für Kinder auszuweiten und ein verbessertes Einleitungswesen für Vorsorgeuntersuchungen für alle Altersgruppen zu etablieren. Das erinnert ein wenig an das Gesunde-Herz-Gesetz. Und dazu haben wir einiges gemacht letztes Jahr. Es ist wie so vieles, was jetzt kommt – und diese Stichworte, die Sie mir jetzt gleich zuwerfen, die bestärken das Bild –, es ist kein Gesamtkonzept vorhanden, es ist ein Sammelsurium aus Einzelaspekten. Es sieht aus wie ein willkürliches Patchwork-Themengebilde, was wir da an gesundheitspolitischen Dingen finden. Manche Sachen sind natürlich sehr sinnvoll, aber es kommen auch so ein paar Anteile von Dingen, die wir eigentlich geglaubt haben, überwunden zu haben und dazu gehören diese Vorsorgevorhaben. Dazu haben wir eine Menge gesagt. Es gibt den Healthy Volunteer Bias. Man erwischt durch Vorsorgeprogramme in der Regel die, die sich ihre Gesundheit bestätigen lassen wollen. Und die Sozialbenachteiligten, die eigentlich dann auch eher von verhältnispräventiven Settingansätzen profitieren würden, die fallen dann eben mal wieder durch den Rost.
Nößler: Kurz noch mal stehengeblieben bei der Vorbeugemedizin. Also sie haben gesagt, die U-Untersuchungen wollen sie ausweiten. Da rutscht dann auch diese eine Idee aus den Plänen für das Gesunde-Herz-Gesetz mit rein und besseres Einladungswesen. Wenn ich mal kurz bei den U-Untersuchen und bei den Kleinsten bleibe einerseits und Einladungswesen jetzt mal nur beispielhaft für das Mamma-Screening beispielsweise nehme. Das sind doch eigentlich tendenziell sinnvolle Konzepte. Also gerade bei Mamma-Screening sieht man ja ein Überlebensvorteil, den man dadurch erreichen kann, wo auch im Einladungswesen ja gerade versucht, diesen Healthy Volunteer Bias so ein bisschen zu durchbrechen, indem ich alle Leute adressiere, oder? Also das muss ja nicht per se etwas Schlechtes sein, wenn man es für die richtige Leistung macht.
Scherer: Wenn man es für die richtige Leistung macht, ist es per se nichts Schlechtes. Es muss aber für jede Leistung, für die man das macht, eine gewisse Evidenz da sein und ein gewisser Wirksamkeitsnachweis, sofern es Pubmed gibt, mit dem man dann diese Wirksamkeitsnachweise dann auch in den einzelnen Shootings findet.
Nößler: Noch gibt es Pubmed.
Scherer: Ja, noch gibt es das. Und vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Es droht abgeschaltet zu werden. Die Warnungen mehren sich. Es werden schon Backups gezogen. Wir können froh sein, solange wir es noch haben. Da guckt man das dann nach. Und wenn man dann Wirksamkeitsnachweise für die einzelnen Maßnahmen findet, dann ist es auch okay. Es wäre aber sinnvoll, es wäre in ein Gesamtkonzept eingebettet.
Nößler: Gehen wir das Patchwork noch mal ein bisschen durch. Vielleicht auch dazu noch der Hinweis, dass wir hier einzelne Punkte aufgreifen. Wir machen nicht diese elf Seiten in toto, dann hätten wir wahrscheinlich hier eine Mehrstunden-Aufnahme. Wir gucken uns einzelne Aspekte an. Und Martin Scherer, vielleicht auch noch wichtig: Die Dinge, die wir ansprechen, zum Beispiel dieses Papier, die Berichte, dass Pubmed so ein bisschen ein Problem kriegen könnte, wenn Trump weitermacht oder Elon Musk. Wo verlinken wir das alles hin?
Scherer: In den Shownotes.
Nößler: In den Shownotes, das können wir nämlich gut. Also Vorbeugemedizin – hier die Warnung von Martin Scherer, bitte nicht Gießkanne, sondern erst mal Evidenz suchen und dann etablieren. Das Nächste, was man findet in dem Papier ist das Thema Psychische Gesundheit. Das findet man eigentlich fast in jedem Koalitionsvertrag immer wieder. Und hier auch ganz besonders der Begriff Einsamkeit, der hier genannt ist. Was planen die dort?
Scherer: Das ist auch ein sehr wohlmeinender und grundsätzlich sinnvoller Ansatz, wie die allermeisten Dinge natürlich auch eine Rationale haben, die nicht von der Hand zu weisen ist. So ist es auch hier. Einsamkeit ist mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden. Und das zeigen Metaanalysen. Und es gibt auch ein HTA zu diesem Thema, beauftragt von IQWiG im Jahr 2022 an das Hamburger Institut und Poliklinik für Allgemeinmedizin. Da haben wir dann einen HTA vorgelegt mit der Arbeitsgruppe unter Dagmar Lühmann. Und das war so, dass einige Maßnahmen gegen Einsamkeit im Alter tatsächlich auch vielversprechende Effekte gezeigt haben, zum Beispiel regelmäßige Besuche durch ehrenamtliche Gleichaltrige, gemeinsame Aktivitäten mit Studierenden, kreative Gruppenangebote oder auch psychotherapeutische Gespräche. Aber insgesamt bleibt die Studienlage schwach. Die Wirksamkeitsnachweise reichen noch nicht für ganz klare Empfehlungen. Also Fazit zum Thema Angebote mit Fokus auf Einsamkeit: Es gibt erste Lichtblicke, aber noch keinen belastbaren Standard.
Nößler: Wäre es zum Beispiel denkbar – ich meine, wir hätten mal eine Episode gemacht über Social Prescribing, ist auch schon ein paar Tage her – wäre das ein mögliches Mittel gegen Einsamkeit? Und wäre es zum Beispiel klug, dass man das beispielsweise im Rahmen eines Innovationsfondsprojektes im Rahmen einer mehr oder weniger kontrollierten Intervention mal untersucht?
Scherer: Social Prescribing ist nicht nur ein wirksames Mittel gegen Einsamkeit, sondern denkbar und einsetzbar bei vielen sozialen Problemen. Und tatsächlich auch ein neuer Forschungsschwerpunkt, ein neues Forschungsgebiet in der allgemeinmedizinischen Forschung. Und es gibt auch schon Projekte, ein größeres EU-Projekt zum Social Prescribing, federführend von der Allgemeinmedizin, der Charité und Wolfram Herrmann. Hamburg ist auch mit dabei. Und es gibt noch eine Reihe anderer Projekte. Also das Thema Social Prescribing ist absolut im Kommen.
Nößler: Das ist jetzt schon mal ein Cliffhanger für die Zukunft, ein Thema, mit dem man sich noch öfter auseinandersetzen kann. Wenn wir quasi beim Thema Einsamkeit sind, dann sind wir in kommunalen Settings, Dinge, die man idealerweise auch über Verhältnisprävention verbessern könnte. Dann bleiben wir gerade mal im kommunalen Bereich, kommen wir zum öffentlichen Gesundheitsdienst. Es gibt den Pakt für den ÖGD, da haben wir wahrscheinlich alle von gehört, in der Pandemie beschlossen, ich glaube 3 Milliarden Euro. Und den wollen die fortführen, Martin Scherer.
Scherer: Die Pandemie hat uns gezeigt, dass sehr viel geleistet wurde im öffentlichen Gesundheitsdienst, dass aber auch der Öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt werden musste. Das ist dann auch passiert. Und diese Stärkung ist sinnvoll und muss beibehalten werden. Es gibt jetzt auch Professuren, die zunehmend ausgeschrieben werden. Es gibt eine Akademisierung des Fachs, es gibt eine Fachgesellschaft jetzt auch für den Öffentlichen Gesundheitsdienst der DGÖD, der Öffentliche Gesundheitsdienst entwickelt sich auf allen Ebenen, er wird akademisiert, und das ist eine gute Entwicklung.
Nößler: Immerhin. Also ÖGD stärken – ja, klar. Wenn man über die Dinge spricht, die wir eben schon hatten, alles, was Prävention betrifft. Dann tauchen an diesem Papier – manche werden sich das Papier vielleicht auch schon angesehen haben – immer wieder so Passagen auf, die sind entweder rot formatiert oder blau. Und das sind dann – jedenfalls zu dem Zeitpunkt dieser Papiere, die sind so Mitte März fertig geworden – nicht konsentierte Forderungen, rot, die sind von der SPD, wo die Union nicht mitgehen will und blau vice versa. Und eine Forderung – in dem Fall hier eine rote – ist der Wunsch, die Pandemie aufzuarbeiten. Wie gesagt, nicht konsentiert, müssen wir gucken. Braucht es das noch? Ist doch jetzt auch schon fünf Jahre durch.
Scherer: Das ist eine ganz witzige Forderung. Ich weiß gar nicht, wo die so schnell herkommt und wer das jetzt wem in die Feder formuliert oder diktiert hat. Es macht natürlich Sinn, wenn man sich für die Zukunft gut aufstellen will und auch über so was spricht wie die Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und des Gesundheitswesens für künftige Krisenfälle. Dann macht es natürlich auch Sinn. Das haben wir immer wieder gesagt, aus der überstandenen Pandemie zu lernen. Wir haben das für unsere Fachgesellschaft, für die DEGAM gemacht. Wir haben auch ein Papier gemacht und hatten das auch mal bei einer Bundespressekonferenz, bei einer Veranstaltung dann vorgestellt. Haben Sie moderiert, Herr Nößler. Und Sie erinnern sich sicherlich an verschiedene Initiativen, die gegründet wurden und die lautstark die Aufarbeitung der Pandemie gefordert haben. Diese Initiativen wurden entweder nicht wahrgenommen oder bewusst überhört. Jedenfalls gab es zu der Zeit vor zwei Jahren in der Politik relativ wenig Bestrebungen, das Thema noch mal strukturiert aufzuarbeiten. Interessant, dass es jetzt in diesem Papier so um die Ecke kommt, wenngleich nicht konsentiert. Aber es ist tatsächlich auch nie richtig passiert. Also man hat wirklich nie richtig mal analysiert, was hat jetzt eigentlich was gebracht. Was könnte man das nächste Mal besser machen, was sind die bewährten Dinge, auf die wir aufbauen können.
Nößler: In der Ampelkoalition ist es unter anderem daran gescheitert, dass die FDP darauf gedrungen hat, einen Untersuchungsausschuss zu machen, und da wollte die SPD nicht mitgehen, weil die sagte: Ich mache doch keinen Untersuchungsausschuss, der gegen mich selbst gerichtet ist. Und bei einer künftigen – na ja, große Koalition können wir sie nicht nennen, wie haben wir sie neulich genannt? Die NoKo, die Notkoalition. Da könnte man sie jetzt auch fragen, da jetzt ein Jens Spahn, der war früher Gesundheitsminister und dann Karl Lauterbach irgendwie Teil dieser Koalition, ob die jetzt ein großes Interesse haben aufzuarbeiten, was man auch an Fehlern gemacht hat. Glauben Sie daran, dass das kommt?
Scherer: Das muss man sehen. Es wäre natürlich sinnvoll, sich das noch mal wirklich strukturiert vorzunehmen das Thema, dass auch die Politik noch mal ihre Lehren daraus zieht. Und es könnte natürlich auch dabei helfen, bestimmte konzeptionelle Linien glattzuziehen für die Zukunft, für künftige Krisen, wo dann auch bestimmte andere Dinge einsortiert werden, sodass unsere ganzen Patchwork-Aspekte dann vielleicht auch einen Rahmen kriegen.
Nößler: Wenn man denn die Pandemie aufbereiten oder aufarbeiten wollte – also das ist ja dann nicht die Pandemie, die man aufarbeitet, sondern es sind ja die Maßnahmen, über die man sich noch mal verständigt und eigentlich überlegen sollte, welche davon waren tauglich, welche nicht. Kinder zu Hause einzusperren und Ältere in Heimen einzusperren, sind es wahrscheinlich nicht gewesen. Da ist man sich ja fast schon einig im Moment. Aber wenn man über das Thema Pandemieaufarbeitung spricht, dann ist man ja auch bei dem Thema Datenblindflug. Also wie oft haben wir darüber gesprochen, dass wir nicht wissen, was wir tun, weil wir keine Daten dafür haben, weil wir auch keine klinischen Studien machen konnten, wie das andere Länder gemacht haben, jedenfalls nicht in der Geschwindigkeit. Und beim Thema Daten sind wir letztlich dann bei einer Forderung, dass auch das Thema Gesundheitsdaten und die Nutzung und die Erstellung und die Genese und auch das ausgebaut werden soll. Was wollen die da machen?
Scherer: Also im Rahmen des geplanten Gesundheitsdatennutzungsgesetzes sollen Hürden für eine verbesserte Datennutzung und einen verbesserten Datenaustausch beseitigt werden. Und das zielt dann darauf ab, dass die Nutzung von Gesundheitsdaten zum Beispiel auch für Präventionsprogramme, Forschung und digitale Gesundheitsanwendungen erleichtert werden. Es gibt auch eine gewisse Evidenz dafür und auch Beispiele in der Literatur, dass datengetriebene Präventionsansätze die Effizienz und die Treffsicherheit von Maßnahmen erhöhen können. Es gibt Erfahrungen aus anderen Ländern, die zeigen, dass wenn man Datensysteme integriert, zum Beispiel bei Impfprogrammen oder auch bei der Krebsvorsage, dass man dann auch die Effekte der Maßnahmen, da wo sie wirken sollen, auch verbessern kann. Natürlich hat die Pandemie uns das ganz besonders vor Augen gezeigt, dass uns vernetzte Datenkonzepte gefehlt haben, dass Datenübertragungen sehr schwer waren, dass auch die Brücke zwischen der Allgemeinmedizin und dem ÖGD nicht gut funktioniert hat. Das muss in Zukunft sicher besser werden. Aber man darf bei diesen ganzen Sachen nicht vergessen, es gibt auch jetzt schon Datensätze, Routinedatensätze, bei den Krankenkassen beispielsweise, wo wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach nicht gut genug rankommen. Und dann braucht man irgendeinen Zugang oder ein Innofonds-Projekt oder man muss jemanden kennen bei den Krankenkassen, um an diese Daten ranzukommen. Also es gibt sehr fähige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch sehr viel mehr machen könnten, wenn der Zugang zu den Routinedaten, die wir jetzt schon haben, besser genutzt werden könnte. Und ich will hier mal ein paar Beispiele geben. Also wenn junge Leute mit muskuloskelettalen Beschwerden kommen, dann haben die oft schon ihr MRT, und oft nicht eins, sondern mehrere und dann bei unterschiedlichen Anbietern. Und dann gibt es Menschen, die haben auch mehrere Hausärztinnen und Hausärzte, einen, der gut zuhören kann, einer, der schöne Überweisungen macht und der Dritte hat vielleicht den Finger etwas locker, wenn es darum geht, ein Heilmittelverordnungsrezept zu unterschreiben. Also wir haben jetzt schon Daten und wir haben jetzt schon Ressourcenverbrauch, Ressourcenverschwendung im System. Und man könnte eigentlich auch jetzt schon die Daten nutzen, um die Geldverschwendung, Geldverbrennung besser zu monitoren und dann auch einfach zu unterbinden. Also Daten sind auch jetzt schon da.
Nößler: Sie sprechen von Routinedaten. Also das sind ja oftmals dann Sekundärdaten, an die Sie gerne leichter kommen möchten: Abrechnungsdaten, Codierdaten et cetera. Wenn Sie jetzt von den multiplen MRT-Befunden sprechen, die jemand bekommen hat, weil er Rückenschmerzen hatte oder was auch immer, dann sind wir ja an den Punkt, dass wir, um die Befundung auszuwerten, um die für Forschung benutzen zu können, dass wir erst mal eine funktionierende e-Patientenakte bräuchten.
Scherer: Das sind Sie jetzt bei den inhaltlichen Fragestellungen, die natürlich ebenfalls sehr wichtig sind und die man sich auch in allen Farben ausmalen kann. Aber das Leistungsmerkmal haben wir jetzt schon. Und wenn Sie dann sehen in den Routinedaten, dass jemand bei unterschiedlichen Behandlungen und unterschiedlichen Behandlern unterschiedliche oder ähnliche diagnostische Maßnahmen bekommen hat, dann kann das durchaus schon ein Hinweis dafür sein, dass man sagt: Moment, was haben wir denn jetzt eigentlich davon.
Nößler: Das hatten wir in einer der letzten Episode. Sie erinnern sich, ne? Über das Thema Low Value Care, da hatten wir auch über diese Daten gesprochen.
Scherer: Richtig.
Nößler: Gut. Zum Thema Daten: also Hürden abbauen und der Versorgungsforscher Scherer sagt: Wichtig ist da unter anderem da auch den Zugang zu den jetzt schon vorhandenen Daten einfach zu verbessern, die Antragsbürokratie reduzieren und so weiter und so fort. Kommen wir noch mal zu dem Thema Kinder und Jugendliche. Wir hatten eingangs schon das Beispiel Vorbeugemedizin, da kamen die U-Untersuchungen. Und tatsächlich Kinder- und Jugendgesundheit wollen die Koalitionäre in spe auch verbessern. Was wollen die da tun?
Scherer: Es soll ein Pakt für Kindergesundheit beschlossen werden mit besonderem Blick auf Angebote in Schulen. Und Ziel ist es, dann auch die Resilienz bei den Kindern und Jugendlichen zu stärken, zum Beispiel durch Schulgesundheitsprogramme, Präventionsprojekte an Schulen und dann auch eine bessere Verzahnung hinzukriegen von Jugendhilfe, Schule und Gesundheitssystem. Das ist ein durchaus sinnvoller Ansatz. Und es gibt auch Reviews mit gemischten, aber tendenziell positiven Ergebnissen, die zeigen, dass das in die richtige Richtung gehen könnte. Und wir von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin reden eh schon lange von Verhältnisprävention und Settingansätzen, nicht erst seit dem Gesunden-Herz-Gesetz. Also das, was hier geplant ist oder was hier anklingt, geht in die richtige Richtung. Man fragt sich natürlich, wie so was in einem überforderten System Schule funktioniert. Das mutet ein bisschen so an, als ob jemand zerrissene Klamotten anhat und sich dann eine schöne Mütze aufsetzt. Also wenn Sie jetzt einen guten Baustein haben in einem System, das insgesamt nicht gut funktioniert, dann ist es auch hier so, dass man vielleicht erst mal sehen müsste, wie kriegen wir eigentlich die Infrastruktur hin, wie kriegen wir die jetzigen Aufgaben um Inklusion und Integration in der Schule gewuppt, wie kriegen wir die jetzigen Personalprobleme hin. Wie kriegen wir das System Schule denn jetzt erst mal richtig zum Laufen. Und dann funktioniert das sicherlich auch gut, das noch zu verknüpfen mit Settingansätzen, die die Gesundheitsförderung im Blick haben.
Nößler: Ich erinnere mich die Tage an eine Reportage, die im NDR erschienen ist – das muss letzte Woche gewesen sein – von einer Quereinsteigerin in den Lehramtsberuf Biologin, die dann keine Lust mehr hatte zu forschen und die dann sagte: Dann gehe ich halt Lehramt. Hat dann noch schnell irgendwie so ein bisschen da ihre Seminare gemacht und landete dann in einer Hauptschule, wo sie Leute in der Sekundarschule dann unterrichtete. Und die hatte bei der Reportage so eine Bodycam einfach auf dem Kopf. Und die Kids haben da auch wohl mitgemacht und da konnte man ihren Alltag begleiten. Und die sagte dann, als sie da reinkam ganz frisch, dass viele – 14-, 15-Jährige im Übrigen – nicht mal lesen und schreiben können. Da fragt man sich – um da anzuknüpfen, was Sie gerade gesagt haben –, Pakt für Kinder- und Jugendgesundheit klingt sehr vernünftig, dass man sich um die Kids und die Jugendlichen kümmert, aber wenn schon die Basis des Bildungssystems nicht mehr funktioniert, da haben wir, glaube ich, da erst mal was zu ändern, oder?
Scherer: Genau so ist es, Herr Nößler. Sie haben das eigentlich perfekt illustriert, was ich eben ausdrücken wollte, dass solche Angebote verzahnt sein müssen mit den grundlegenden Elementen der Bildung.
Nößler: Bildung ist Prävention. Auch das ist nichts Neues. Bleiben wir bei der Prävention. Was man dort auch findet in diesem Arbeitsgruppenpapier ist das Thema Suchtprävention, Martin Scherer. Und wir wissen, dass die Union die Cannabis-Legalisierung wieder rückabwickeln will. Was wollen die noch machen?
Scherer: Sie wollen angesichts zunehmender Suchterkrankungen, zum Beispiel auch durch synthetische Drogen, noch mal wirklich an die Prävention, an die Suchthilfe rangehen. Es soll gezielte Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche geben, die auch Alltagssüchte adressieren, zum Beispiel auch Nikotin und Alkohol, auch exzessiver Medienkonsum. Das ist ja etwas, was unser Kollege vom Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters, Prof. Thomasius vom UKE in Hamburg seit Jahr und Tag sagt: Wir müssen ran an die Computersucht. Und Prof. Thomasius ist übrigens auch ein großer Kritiker der Cannabis-Legalisierung. Das soll gemacht werden. Wir haben ja hier das Evidenz-Update, wenn man ein bisschen in die Literatur schaut, dann gibt es für solche Strategien, die verschiedene Dinge kombinieren, also Prävention, Frühintervention, Schadensminderung, dass das schon Best-Practice-Ansätze sind. Aber es gibt natürlich auch Studien, die zeigen, dass Aufklärung alleine nicht ausreicht und man dann schon auch Zugangsbeschränkungen braucht. Also muss von unterschiedlichen Seiten kommen. Aufklärung, Edukation, aber auch Zugangsbeschränkungen.
Nößler: Machen wir gerade noch mal weiter. Ist jetzt kein Präventionsthema im klassischen Sinne. Organspende, findet sich auch in guter Tradition in so einem Prä-Koalitionsvertragspapier wieder. Was wollen die da machen? Vielleicht doch die Widerspruchsregelung? Oder eher nicht?
Scherer: Auf jeden Fall möchte man die Zahl der Organspenden in Deutschland deutlich erhöhen. Und hierfür sollen die Voraussetzungen verbessert werden. Best-Practice-Beispiel ist in dem Fall Spanien, wo man von unterschiedlichen Seiten auch gekommen ist. Auch hier wieder ein Beispiel dafür, dass nicht eine Maßnahme ausreicht, sondern man einen Maßnahmenpaket machen muss. Da gibt es Aufklärung, Aufklärungskampagnen, da gibt es strukturelle Maßnahmen, wie zum Beispiel Organspendenbeauftragte an den Kliniken. Aber es gibt eben auch die Opt-out-Lösungen. Wahrscheinlich ist das dann auch der Weg, über den man dann die Zahlen hochkriegt, dass man eben – wie Sie es nennen – eine Widerspruchslösungen macht. Wir haben im Augenblick noch Opt-in und haben unsere Schwierigkeiten damit. Das wäre es wahrscheinlich. Also in Spanien funktioniert es und in Spanien gibt es auch die besten Zahlen hinsichtlich der Organspende.
Nößler: Die Union ist ja alles andere als eine starke Befürworterin einer Widerspruchsregelung. Und ich fürchte, dass es mit einer unionsgeführten Regierung, die nicht geben wird. Was mich wundert, um mal bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben – und das könnten wir wahrscheinlich bei tausend anderen Beispielen machen –, Martin Scherer, das Thema Spanien bei der Organtransplantation, das ist ja jetzt nicht so, als hätten wir gestern dazu die Breaking News alle bekommen und gesagt: Oh, Wunder, schaut euch mal die erfolgreichen Spanier an, die Ü50-Spenden pro Millionen Einwohner realisieren, so ähnlich wie die USA im Übrigen, und in den US-Staaten gibt es in sehr Vielem keine Widerspruchsregelung. Man wundert sich immer, dass die Antworten seit Ewigkeiten bekannt sind und seit Ewigkeiten genauso konsequent nicht umgesetzt werden.
Scherer: Es mangelt eben oft nach am Wissen. Und wir haben auch in vielen Bereichen kein Erkenntnisproblem. Aber wir tendieren schon dazu, die Sachen kompliziert zu machen und dann von unterschiedlichen regulatorischen Seiten abzuwägen und dann auch regulatorische Elemente vielleicht oftmals Übergewichten und deshalb funktioniert das auch nicht mit dem Bürokratieabbau beispielsweise. Ich will das jetzt nicht vermengen mit dem Thema Bürokratieabbau, denn da sind medizinethische Themen natürlich drin in der Organspende. Aber wir sind schon gut da drin, die Dinge dann auch irgendwie kompliziert zu machen.
Nößler: Wir machen Papiere, wir können Arbeitskreise, schreiben alles zigfach auf, aber so richtig was Progressives findet nicht statt. Vielleicht noch ein anderes Beispiel: Sie haben, als wir zur Prävention eben kamen, über den Pakt für Kinder- und Jugendgesundheit gesprochen und die durchaus vernünftigen Gedanken hinsichtlich Settingansätzen, Verhältnisprävention, wohl wissend, dass da viele Dinge im Vorfeld bitte noch zu tun wären. Aber auch da wieder so ganz banale Sachen. Ich nenne mal die Zuckersteuer, Marin Scherer, die im UK bewiesen hat, dass sie einen Effekt hat, was den Konsum von gezuckerten Getränken angeht, was effektive Diabetes- oder Adipositas-Prävention sein könnte, findet sich hier wieder nicht. Man reibt sich doch verwundert die Augen.
Scherer: Das ist schon ein Problem, dieser Reflex über die Aufklärung der Medizin zu gehen. Denken Sie nur an den Herzgipfel jetzt wieder. Wir könnten so viel Leben retten – stand ganz dick in der Bildzeitung. Also da würde ein medikalisierungsgetriebenes Bild an die Wand geworfen, bei dem man durch eine omnipotente Medizin mit ganz viel Verhaltensprävention Leben retten kann. Das tut schon weh. Und das beleidigt in gewisser Weise auch den gesunden und auch den wissenschaftlichen Menschenverstand. Und das dickere Brett wäre tatsächlich zu bohren bei der Verhältnisprävention. Da könnte man viel machen. Die Settingansätze in den Schulen gehen schon ein bisschen in die richtige Richtung, aber mit Ernährungs-, Bewegungsangeboten, zum Beispiel auch mit dem Verbot von Süßigkeitenwerbung für Kinder gäbe es noch viele Maßnahmen, die nicht angepackt werden und wo man schlichtweg sagen muss: Entweder scheitert die Verhältnisprävention an der Feigheit der Politik oder an der Ignoranz der Politik. Aber an mangelnden Erkenntnissen kann es nicht liegen.
Nößler: Das war wieder eine schöne Überschrift. Cool! Immer so zum Ende hin, entweder scheitert sie an der Feigheit oder der Ignoranz der Politik. Sehr schön. Wir haben jetzt einige Dinge herausgepickt. Und manche werden sich wundern, dass wir vielleicht ein paar ganz große Aspekte heute nicht besprochen haben, das ist das Thema Patientensteuerung ...
Scherer: Ja, da warte ich drauf, Herr Nößler.
Nößler: Das wollen Sie heute auch noch besprechen?
Scherer: Na, hören Sie mal! Was sollen denn die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen? Dann sagen die: Was ist denn mit Nößler mit Scherer los?
Nößler: Ja, die picken sich wieder die irrelevanten Themen raus.
Scherer: Jetzt reden die irgendwie 35 Minuten über Gesundheitspolitik im Rahmen der Koalitionsverhandlung und kein Wort zur primärärztlichen Steuerung. Wollen Sie da wirklich machen?
Nößler: Wir können es ja mal versuchen. Man kann sich ja auch mal ein bisschen überraschen, mit anderen vielleicht auch halbseitigen Themen – wobei, das ist jetzt alles nicht Halbseiten, was wir da besprochen haben – beschäftigen. Ich sage mal so: Unter der Hand, wenn ich jetzt Martin Scherer frage, was er von der primärärztlichen Steuerung, von dem Primärarztsystem hält – ich will jetzt nicht sagen Banane – aber es wird ein Stück weit erwartbar sein. Aber sprechen wir es in jedem Fall man an. Sie haben natürlich recht. Es ist vorgesehen und ich glaube, das wollen die auch in den ersten 100 Tagen machen, dass sie ein verbindliches primärärztliches System einführen wollen, wobei da auch wieder eine Freiwilligkeit drin sein wird, also Kinder- und Hausärzte sollen erste Anlaufstelle werden und sollen dann quasi zuweisen in die gebietsärztliche Versorgung. Es soll Ausnahmen geben bei Gyn und Augenheilkunde. Auch das ist soweit erwartbar. Und außerdem haben sie sich vorgenommen, innerhalb der ersten 100 Tage das Thema Akut- und Notfallversorgung/Rettungsdienst neu zu regeln. Für alles gibt es ja Vorschläge hinlänglich, schon seit Jahren. Wie bewerten Sie das? Ist das jetzt mal so ein Break-through-Ereignis, auf das wir da zusteuern? Oder trauen Sie dem Braten noch nicht?
Scherer: Auf das wir zusteuern. Es ist eine schöne Zweitverwendung des Begriffs in diesem Kontext, Herr Nößler. Also natürlich ist es schon so, dass man bei uns, bei der der DEGAM mit dem Thema primärärztliche Steuerung offene Türen einrennt. Da warten wir eigentlich seit sehr langer Zeit drauf. Nicht, weil es ein nerdiges Hobby von uns ist, sondern weil wir hier eine wesentliche Stellschraube sehen, dafür die Mittel in unserem Gesundheitssystem sinnvoller einzusetzen und auch die Gesundheitsversorgung insgesamt zu verbessern. Also wir haben das noch mal dargelegt in einem Positionspapier im Januar 2025, also ganz frisch, mit dem Titel: Mehr Qualität durch hausärztliche Steuerung in der Gesundheitsversorgung. Und in diesem Papier legen wir dar, dass ein hausärztliches Primärversorgungssystem mit obligater Einschreibung absolut positive Effekte hätte, zum Beispiel auf die Versorgungseffizienz oder auch auf die patientenbezogene Qualität oder auch auf die Gesamtbelastung im Gesundheitssystem. Also Krankenhauseinweisungen, unnötige Mehrfachbehandlungen würden dadurch gesenkt werden. Und wir würden auch die Effizienzreserven durch hausärztliche Praxisteams viel besser einsetzen. Und vor allem – das darf man auch nicht vergessen – beschreiben wir in diesem Papier auch noch mal, wie es geht. Also hausärztliche Steuerung, dafür muss man eine Qualifikation mitbringen durch Fort- und Weiterbildung, insbesondere durch die allgemeinmedizinische Weiterbildung. Und das ist nicht etwas, was dann auch mal der Orthopäde machen kann oder so, sondern das ist etwas, was man können muss, was man gelernt haben muss und was, wie gesagt, auch Teil der strukturierten Weiterbildung ist.
Nößler: Dann wird das Papier aber an anderer Stelle dann inkonsistent – nenne ich es mal zurückhaltend. Wenn einerseits von einer verbindlichen primärärztlichen Steuerung gesprochen wird, aus dem hausärztlichen Bereich – da ist jetzt die Kinder- und Jugendheilkunde mit gemeint, einerseits. Andererseits dann aber auch eine Art Termingarantie eingeführt werden soll. Das kommt offenbar von der SPD, jedenfalls hatten die das im Wahlkampf breit thematisiert, wo dann drinsteht, dass wenn dieser gebietsärztliche Termin, den ich von meinem Terminservicezentrum bekomme, nicht eingehalten werden kann – warum auch immer, vielleicht weil es einfach keine Kapazitäten gibt –, dann darf ich ins Krankenhaus und bekomme dort die ambulante Leistung erbracht. Das, Martin Scherer, ist doch alles nicht konsistent.
Scherer: Das ist überhaupt nicht konsistent. Das ist auch nicht die kleinteilige Herangehensweise. Beziehungsweise ist das eine kleinteilige Herangehensweise, die eben dann dieses Flickwerk in der Gesundheitsversorgung auch kennzeichnet und die wir nicht wollen. Was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen qualifizierte Überweisungen, wir wollen, dass die Patientin oder der Patient hausärztlich beraten, untersucht wird und dass dann, wenn eine Überweisung notwendig ist, die qualifiziert erfolgt. Und dann wiederum die spezialfachärztliche Expertise auch zeitnah in Anspruch genommen werden kann und nur bei solchen Patientinnen und Patienten, die dafür auch eine Indikation haben. Wir wollen doch eigentlich Ordnung bringen ins System. Und wenn wir die Pyramide umkehren und die Sekundär- und Tertiärversorgung zu Primärversorgung machen, dann bringen wir da keine Ordnung ins System. Dann würden wir die Sache auf den Kopf stellen, dann haben wir erst richtig Chaos.
Nößler: Und vor allem, man will es ja einfacher machen das System. Es ist ja heute schon nicht mehr durchschaubar. Und die Probleme, die wir haben, haben wir doch auch deswegen, weil die Leute gar nicht wissen, was zu tun ist. Da sind wir so ein bisschen jetzt an – was heißt ein bisschen, sind wir jetzt – wir haben das Thema Patientensteuerung angesprochen, wir haben die akute Notfallversorgung angesprochen – Episode gerettet, würde ich sagen, Check. Jetzt können wir noch mal so ein bisschen eine Klammer unter diese ganzen Geschichten machen. Sie haben initial das kritisch betrachtet oder Sie haben das kritisiert, was da vorliegt als Patchwork-Themengebilde, haben Sie es genannt. Kann man nicht sogar so weit gehen und sagen, Martin Scherer, das, was da im Moment vorliegt, was da alles fragmentarisch aneinandergereiht ist, von jedem ein bisschen was, bloß nichts, was irgendwem wehtut, hier noch ein bisschen mehr, da noch ein bisschen mehr, hier so ein paar Pseudoeinsparungen – kann man das nicht auch so eine All-you-can-eat-Politik nennen?
Scherer: Was man halt mit Stoffwechselendprodukten dann eben so macht. Aber jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich dieses Bild aus dem Kopf kriege. Machen wir es mal ein bisschen anders.
Nößler: Das ist doch eine schöne Verbindung. Wir hatten in der letzten Episode vom CAC-Score gesprochen.
Scherer: Also das Thema ist leider zu ernst und verlangt eigentlich nach einem klaren Zielbild. Ich sage mal so, in meiner universitären Welt würde so was hier als Projekt klar nicht durchgehend. Sondern da würden nach Zielvorstellungen gefragt werden und nach Meilensteinen und nach Arbeitspaketen und wie können wir dieses Zielbild a) formulieren und dann auch b) realisieren. Und das Zielbild müsste doch eigentlich sein, dass wir, so wie es der Sachverständigenrat schon vor vielen Jahren formuliert hat, Über-, Unter-, Fehlversorgung vermeiden, dass wir auf der einen Seite die Versorgung verbessern, dass wir Unnötiges weglassen und dann einfach auch Ressourcen sparen. Denn ich gehe ganz fest davon aus, um das hier auch einmal ganz deutlich zu sagen, dass das, was wir an Unterversorgung in unserem System haben, die Kehrseite und die Konsequenz von Überversorgung an falscher Stelle ist. Und deshalb wäre es gut, einfach noch mal einen Schritt zurückzugehen, das vielleicht noch mal beiseitelegen, dieses Sammelsurium von Einzelmaßnahmen und zu überlegen, in was für einem Gesundheitssystem wollen wir eigentlich leben und lass uns doch noch mal zusammensetzen und ein halbwegs kohärentes Zielbild mit klaren Zielvorstellungen auch zu formulieren.
Nößler: Politikberater Scherer am Start. Fehlt noch die Soundmaschine.
Scherer: Was fehlt?
Nößler: Die Soundmaschine.
Scherer: Eine Sekunde. (SOUND)
Nößler: Oh, super. Das war jetzt die Selbst-Affirmation. Ich würde sagen, Martin Scherer, sind wir für heute erst mal am Punkt.
Scherer: Würde ich sagen. Also Fortsetzung folgt.
Nößler: Fortsetzung folgt. Das war der Cliffhanger. Wir dürfen alle erwarten, was in Berlin passiert. Wir dürfen alle erwarten, was in der anstehenden mutmaßlichen Koalition passiert. Wenn es passiert ist, dann werden wir noch mal gucken, ob wir einige der Dinge, die wir heute besprochen haben, revidieren müssen, präzisieren müssen, verfeinern oder mehr in die Tiefe gehen müssen. Martin Scherr, ich würde sagen, wir machen den Punkt und ich sage Danke.
Scherer: Ich sage Ihnen eine gute Woche, vielen Dank für diese Episode. Ich freue mich auf die nächste. Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer! Bleiben Sie uns gewogen!
Nößler: Und damit tschüss!