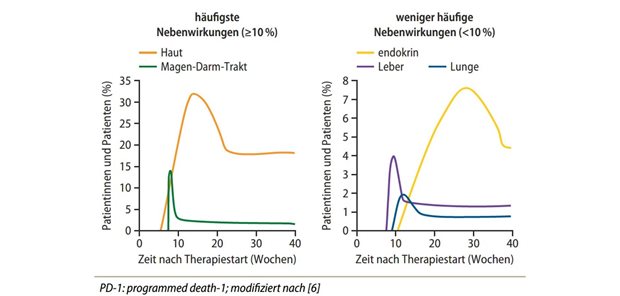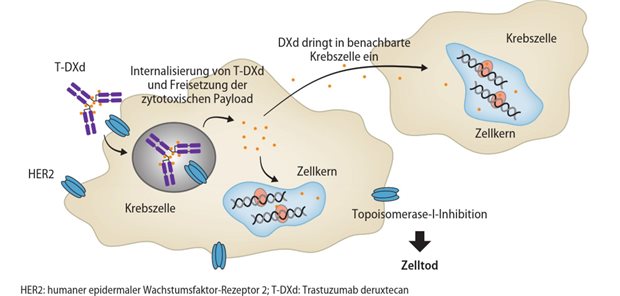Fragen und Antworten
Coronavirus – was wir wissen und was nicht
Immer mehr Details zu SARS-CoV-2 werden bekannt, vieles ist aber weiter unklar. Weltweit nehmen Forscher das neue Coronavirus im Labor unter die Lupe. Ein Überblick über wichtige aktuelle Fragen und Antworten.
Veröffentlicht:
Bei großen Infektionswellen ist es besonders wichtig, das medizinische Personal zu schützen.
© [M] jarun011 / Getty Images / iStock
Berlin. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infizieren, steigt. Und noch immer gibt es viele Fragezeichen.
Doch es wird eifrig geforscht, und die Wissenslücken werden kleiner. Wir geben einen Überblick über wichtige aktuelle Fragen und die derzeitigen Antworten.
Stand 14. Februar gab es weltweit fast 64 .000 registrierte Infektionen. Von diesen Patienten sind knapp 1400 gestorben und 6260 nachgewiesen genesen. Außerhalb Chinas sind aktuell 24 Länder mit insgesamt rund 580 Infektionen betroffen. Nur ein Patient außerhalb Chinas ist bisher gestorben, auf den Philippinen und mit schwerer Grunderkrankung.
Nur insgesamt 17 Patienten außerhalb Chinas hatten oder haben bisher schwere Verläufe. Die Sterberate in China liegt den offiziellen Zahlen zufolge bei 2,0-2,2 Prozent, außerhalb Chinas bei 0,2 Prozent.
Da die chinesischen Zahlen mit großer Unsicherheit behaftet sind, ist das schwer zu sagen. Virologen wie Professor Christian Drosten von der Charité Berlin und auch RKI-Präsident Professor Lothar Wieler vermuten, dass die Infektionszahlen in China wesentlich höher liegen als berichtet.
Wenn es sich bei nicht berichteten Infektionen überwiegend um blande verlaufende Infektionen handelt, wäre die reale Letalität auch in China deutlich geringer. Hinweise für relevante biologische Unterschiede zwischen Chinesen und dem Rest der Welt gibt es bisher nicht. Auch außerhalb Chinas – und damit dort, wo die Letalität scheinbar geringer ist –, sind bisher weit überwiegend Menschen chinesischer Abstammung betroffen. Das spricht dagegen, dass Chinesen aus biologischen Gründen schwerere Verläufe haben könnten.
Eine Sterblichkeit von 0,2 Prozent ist im Rahmen dessen, was auch bei schweren Grippewellen beobachtet wird. Bei den Grippepandemien 1957 und 1968 etwa lag die Letalität in dieser Größenordnung.
Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Mehrheitsmeinung ist, dass sich die Welt derzeit an der Schwelle zu einer Pandemie befindet. Bisher gibt es außerhalb Chinas weiterhin keine Infektionsketten, die sich nicht unmittelbar auf Chinareisen zurückführen lassen. Das dürfte sich aber über kurz oder lang ändern.
Die kurze Antwort lautet: Das ist noch nicht klar. Es gab aber zuletzt einige neue Erkenntnisse. Als nachgewiesen gilt, dass sich das Virus im Rachen repliziert, ähnlich wie die Influenzaviren. Damit unterscheidet es sich von dem SARS-Virus des Ausbruchs im Jahr 2003, das für eine Vermehrung Rezeptoren in den unteren Atemwegen benötigte.
Anders als bei SARS kann infektiöses Virus bei SARS-CoV-2-Infektionen regelmäßig schon bei Patienten in frühen Stadien im Labor aus Rachenabstrichen isoliert werden. Das Virus ist damit leichter übertragbar als SARS. Allerdings ist im Moment Mehrheitsmeinung, dass es nicht (wie etwa das Windpockenvirus) „über die Luft“ übertragen wird, sondern dass es sich um Tröpfchen- und/oder Schmierinfektionen handelt. So werden auch zahlreiche andere Coronaviren übertragen, die den Rachen bevölkern können.
Es gibt eine deutsche Publikation zum Münchener Coronavirus-Cluster, die eine asymptomatische Übertragung prominent beschrieben hat. (N Engl J Med 2020, online 30. Januar) Hier hat sich mittlerweile allerdings herausgestellt, dass die dort beschriebene Patientin nicht komplett asymptomatisch war.
Der Berliner Virologe Professor Christian Drosten, Co-Autor dieser Studie, hält diese Diskussion für praktisch nicht besonders relevant und steht daher weiterhin zu der Publikation. Klar sei, dass zumindest oligosymptomatische Patienten das Virus übertragen könnten. Die meisten Experten gehen davon aus, dass eine asymptomatische Übertragung möglich ist.
Das hängt maßgeblich von der Infektiosität ab, genauer der sogenannten Attack Rate, einer epidemiologischen Kennziffer, die beschreibt, wie viele jener, die hätten infiziert werden können, tatsächlich infiziert werden. Typische Grippepandemien, die in zwei Wellen über den Globus laufen, erreichen eine Attack Rate in der Größenordnung von 30 Prozent.
Ist die Attack Rate deutlich kleiner, würde eine Pandemie eher schleichend verlaufen. Bei einer (sehr unwahrscheinlichen) deutlich größeren Attack Rate käme es zu einer großen Infektionswelle mit nur einem Gipfel. Die Attack Rate des SARS-CoV-2 ist noch nicht bekannt.
Allen bisherigen Daten zufolge sind es alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Insbesondere gibt es bisher nur sehr wenige betroffene Kinder.
Das deutsche Gesundheitswesen kann mit großen Infektionswellen umgehen. Die schwere Grippewelle des Jahres 2017/18 ging mit 10 Millionen Arztbesuchen und 25 .000 Todesfällen einher, letztere – wie beim SARS-CoV-2 – überwiegend bei alten und multimorbiden Patienten.
Damals waren die Krankenhäuser am Limit, haben die Welle aber letztlich gut bewältigt. Eine entscheidende Frage lautet, ob es gelingt, die in der zweiten Januarwoche angelaufene Grippewelle mit bisher 60 Toten von einer SARS-CoV-2-Welle zeitlich zu entkoppeln. Dafür müsste das derzeit erfolgreiche Containment in Deutschland so lange wie möglich durchgehalten werden. Das würde die Krankenhäuser deutlich entlasten.
Limitierend bei Infektionswellen ist in der Regel das medizinische Personal und nicht die Technik. Primär muss es daher darum gehen, das Personal zu schützen und einsatzbereit zu halten. Sehr schwere Verläufe sind beim SARS-CoV-2 nicht die Regel. Die Erkrankung verläuft bei den allermeisten Patienten bisher eher wie eine Erkältung. Von den Patienten in Deutschland hatte bisher nur einer eine Viruspneumonie. Dieser Patient wurde mit Lopinavir/Ritonavir behandelt und befindet sich – ohne ECMO oder sonstige Beatmung – auf dem Weg der Besserung.
Nein. Experten schätzen, dass es selbst unter optimalen Bedingungen bis zur Zulassungsfähigkeit eines Impfstoffs anderthalb Jahre dauern dürfte. Danach müsste es auch noch produziert werden. Das wird für die anstehende Pandemie, so sie kommt, nicht mehr reichen.
Niemand ist schuld, auch nicht die Fledermäuse. Infektionswellen sind Teil der Natur, und sie sind es schon immer gewesen. Wie genau die Infektionskette war, müssen Forscher in mühsamer Kleinarbeit vor Ort herausarbeiten.
Als sehr wahrscheinlich gilt, dass Hufeisennasenfledermäuse – wie bei anderen Coronaviren – der primäre Wirt sind. Eine aktuelle Nature-Publikation hat das – anhand einer genetischen Übereinstimmung von 96 Prozent – noch einmal herausgearbeitet (Nat 2020, online 3. Februar). Sehr wahrscheinlich gab es aber Zwischenwirte. Beim SARS-Virus waren es Nagetiere, beim MERS-Coronavirus Kamele. Für SARS-CoV-2 ist der Zwischenwirt noch unbekannt.
Die Fledermäuse werden übrigens selbst deswegen nicht krank, weil sie als fliegende Säugetiere, deren Körpertemperatur und Herzfrequenz beim Fliegen extrem ansteigt, ein einerseits leistungsfähigeres, andererseits infektionstoleranteres Immunsystem haben als andere Säugetiere.