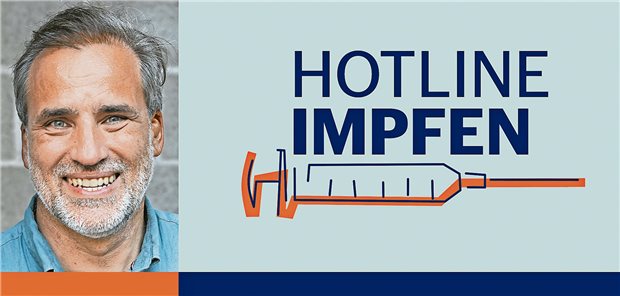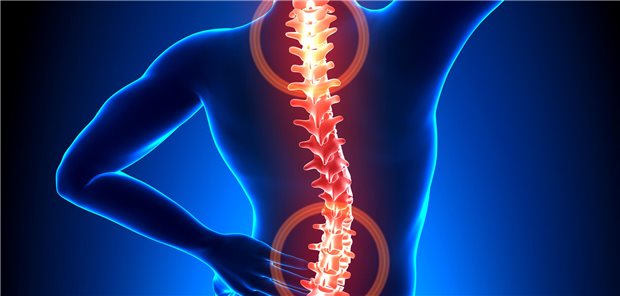Galenus-Preis
Diese fünf Teams sind im Rennen
10.000 Euro und eine Medaille: Damit würdigt der Galenus-Preis besondere Leistungen in der Grundlagenforschung. Die "Ärzte Zeitung" stellt die Forscherteams vor, die es in die Endrunde geschafft haben - von Infektionen über Kardiologie bis hin zur Suchtmedizin.
Veröffentlicht:
Heiß begehrt: die Medaille des Pergamon-von-Galenus-Preises.
© Michael Setzpfandt
Der Galenus-von-Pergamon-Preis, von der Springer Medizin Verlag GmbH gestiftet, wird unter anderem für Forschungsleistungen ausgelobt. In Form einer Medaille und mit 10.000 Euro wird eine Forschungsleistung in der klinischen und/oder experimentellen Pharmakologie gewürdigt.
Weitere Infos in unserem Special
Mehr zum Galenus-Preis 2016 lesen Sie in unserem Special.
Voraussetzung ist, dass die Forschungsleistung für den Fortschritt auf dem Gebiet der Arzneimittel- und Diagnostikaforschung wegbereitend ist und sie außerhalb der pharmazeutischen Industrie an Universitäten oder Forschungsinstitutionen erbracht wurde.
Die fünf Forscherteams und ihre Arbeiten, die wir hier vorstellen, sind 2016 in die Endrunde gekommen. Die Sieger werden bei einem Festakt am 20. Oktober in Berlin bekannt gegeben.
Angiologie
Endothelialer Stoffwechsel reguliert Gefäßwachstum
Die Zellen des Endothels, des Gewebes, das die Blutgefäße auskleidet, können zwischen Zuständen mit unterschiedlichen Ansprüchen an Stoffen für den Energiegewinn und den Aufbau von Zellkomponenten wechseln. In den meisten gesunden Geweben liegen sie in einem Ruhezustand vor, können sich aber als Antwort auf bestimmte Reize hin teilen und fortbewegen. Diese Fähigkeit ist essenziell für das Wachstum und die Funktion der Blutgefäße und scheint auch eine Rolle in pathologischen Prozessen zu spielen, die zur Entwicklung von Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems beitragen. Die molekularen Grundlagen sind bislang nicht umfassend verstanden.
Die Bad Nauheimer Forscher untersuchten die Funktion des Transkriptionsfaktors FOX01 (forkhead transcription factor FOXO1) in einem Mäusemodell (Nature 2016; 529: 216-220). Dabei konnten sie zeigen, dass ein Verlust der Funktion von FOXO1 zu einem unkontrollierten Wachstum des Endothels und einer Vergrößerung von Blutgefäßen führt, während ein Funktionsgewinn eine Ausdünnung des Endothels und ein verringertes Verzweigungsvermögen von Blutgefäßen zur Folge hat. Analysen auf Stoffwechsel- und RNA-Ebene zeigten, dass FOXO1 ein Suppressor von MYC, einem zentralen Treiber des anabolen Stoffwechsels von Endothelzellen ist. Als Gegenspieler fördert FOXO1 den Ruhezustand von Endothelzellen und führt zu einer koordinierten Dämpfung der Stoffwechselaktivität.
Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung, Bad Nauheim
Dr. Michael Potente
Infektionsdiagnostik
Revolution in der Diagnostik invasiver Pilzerkrankungen
Trotz der Verfügbarkeit von effektiven antifungalen Therapien ist die Mortalität bei invasiver Aspergillose (IA) hoch. Das derzeitige diagnostische Standardverfahren besteht in einer Computertomografie (CT) des Thorax, verbunden mit einer Reihe von Serumtests sowie gegebenenfalls einer bronchoalveolären Lavage (BAL), um den Erreger, Aspergillus fumigatus, nach mehrtägiger Kultur und genetischer Analyse identifizieren zu können.
Professor Dr. Gunzer und seinem Team gelang es, ein neuartiges, bildgebendes Verfahren auf Basis der Positronenemissionstomografie/Magnetresonanz (PET/MR) zu entwickeln und im Tiermodell zu etablieren, das sich auch beim Menschen anwenden lässt (Proc Natl Acad Sci USA. 2016;113(8):E1026-1033). Kernstück des Verfahrens ist ein monoklonaler Antikörper mit radioaktiver Markierung (JF5-Cu64), der hochspezifisch an Aspergillus fumigatus bindet. Mithilfe von JF5-Cu64 ließ sich im PET/MR eine IA in Mäusen eindeutig nachweisen, während typische Pneumokokkeninfektionen und andere bakterielle Infekte der Lunge kein Signal lieferten.
Universität Duisburg-Essen, Institut für Experimentelle Immunologie und Bildgebung
Professor Matthias Gunzer
Berlin
Aspidasept®: Duale Therapie gegen deletäre Sepsis-Folgen
Komplizierte Infektionen können zum lebensbedrohlichen Syndrom der Sepsis führen. In etwa der Hälfte der Fälle sind Toxine von grampositiven Bakterien oder Mykoplasmen der Auslöser. Unklar ist, welche ihrer Toxine verantwortlich sind.
Dazu untersuchten die Wissenschaftler aus Aachen und Borstel um Professor Klaus Brandenburg und Professor Tobias Schürholz in einem In-vitro Modell die zytokininduzierende Aktivität verschiedener Toxine. Dabei zeigten sie, dass Lipoproteine und -peptide die potentesten Stimulanzien einer Entzündungsreaktion sind.
In einem Sepsis-Modell der Maus führte ein synthetisches Lipopeptid zu einer proinflammatorischen Zytokinproduktion, wie sie charakteristisch für Sepsis ist (Sci Rep 5, 14292). Dabei erwies sich der für gram-negative Bakterien geeignete Wirkstoff, das Polypeptid Pep19-2.5, als potenter Inhibitor der proinflammatorischen Aktivität in vitro und im Mausmodell. Sepsis kann zur myokardialen Dysfunktion führen. Dieser Effekt wird zurückgeführt auf Entzündungen, die durch pathogenassoziierte Produkte (PAMPs) und durch Schädigung körpereigener Zellen des Patienten entstehende Produkte (DAMPs) hervorgerufen werden. Wie die Forscher bewiesen, kann eine mit PAMPs und DAMPs hervorgerufene inflammatorische Reaktion in Kardiomyozyten ebenfalls von Pep19-2.5i inhibiert werden (PLoSONE:doi:10.1371/journal.pone.0127584).
Mit Pep19-2.5 haben die Wissenschaftler eine Substanz entwickelt, die als antibakterieller/anti-entzündlicher Breitbandwirkstoff eine große Chance hat, Sepsis und sepsisinduzierte Organdysfunktion zu verhindern oder abzumildern.
Forschungszentrum Borstel, Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften
Professor Klaus Brandenburg
Universitätsklinikum der RWTH Aachen, Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care
Professor Tobias Schürholz
Kardiologie
Innovative RNA-basierte Herzinsuffizienz-Therapie
Auf zellulärer Ebene ist der Prozess des kardialen Remodelings durch eine Größenzunahme (Hypertrophie) der Herzmuskelzellen gekennzeichnet. Trotz Fortschritten in der pharmakologischen Therapie bleibt die Prognose schlecht: Bei Betroffenen kann die Größenzunahme des Herzens zu Herzversagen oder zum Tod führen.
Lange, nicht kodierende Ribonukleinsäuren (lncRNAs) sind eine Klasse von RNAs mit einer Länge von mehr als 200 Nukleotiden, die nicht für Proteine kodieren. Sie regulieren verschiedene Stoffwechselwege auf transkriptioneller und posttranskriptioneller Ebene oder durch Chromatinmodifikation und Beeinflussung des subzellulären Traffics. Die Forschergruppe um Professor Thomas Thum und Dr. Janika Viereck konnte zeigen, dass die lncRNA Chast (cardiac hypertrophy-associated transcript) in Mäusen mit künstlich induzierter kardialer Hypertrophie hochreguliert wird und auch im Herzgewebe von Patienten mit Aortenstenose verstärkt gebildet wird (Sci Transl Med. 2016;8(326):326 ra22). Die Hemmung der Expression von Chast im Mausmodell konnte die Krankheitsentwicklung aufhalten und die Herzfunktion verbessern.
Die Untersuchungen deuten nicht nur auf eine generelle Rolle der lncRNAs bei der Entstehung von Erkrankungen des Herzens hin: Mit der Aufklärung der zentralen Rolle von Chast als Treiber der kardialen Hypertrophie konnte das Forscherteam ein potenzielles Ziel für zukünftige Therapieansätze identifizieren.
Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Molekulare und Translationale Therapiestrategien
Professor Thomas Thum, PhD und Dr. Janika Viereck
Suchtmedizin
Substitution bei Opiatsucht: Wirksamkeit und Sicherheit
Opioidabhängigkeit ist eine Erkrankung mit hoher Mortalität und erheblichen Raten psychiatrischer und somatischer Komorbiditäten. Ein etabliertes Konzept zur Behandlung ist die Ersatztherapie mit einem Kombinationsmedikament aus dem Opioid Buprenorphin und dem Opioidantagonisten Naloxon. Allerdings erhöht eine Alkoholsucht das Risiko für Leberschäden und die hohe Prävalenz der Hepatitis C steigert das Risiko der Nebenwirkungen auf die Leber. Dennoch scheint Buprenorphin in konventioneller Anwendung – aufgrund niedriger Dosierung und schneller Verstoffwechselung – mit einer geringen Hepatotoxizität verbunden zu sein.
Die Forschergruppe um Professor Michael Soyka erhob in einer zwölfmonatigen Beobachtungsstudie die Lebersicherheit bei opioidabhängigen Patienten, die nach Vorbehandlung mit Buprenorphin, Methadon oder L-Methadon auf Buprenorphin/Naloxon umgestellt wurden (Am J Addict. 2014;23:563-569). Im Rahmen der Studie zeigten die Patienten keine Anzeichen einer medikamenteninduzierten Lebererkrankung, nur leicht erhöhte Leberwerte. Es traten keine schweren Nebenwirkungen auf. Alle Patienten beendeten die Studie.
Mit dieser Arbeit haben die Forscher eine solide Evidenzbasis für den Einsatz von Buprenorphin/ Naloxon in der Suchtmedizin geschaffen.
Medical Park Klinik in Bernau am Chiemsee
Professor Michael Soyka