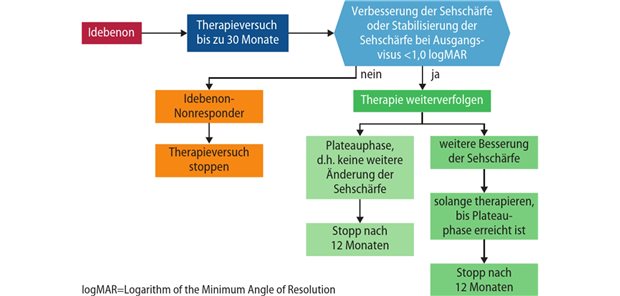Wissenschaftspreis der Stiftung Auge
Drei Augenärzte für Forschung prämiert
Die Stiftung Auge hat drei Wissenschaftler für aktuelle Untersuchungen zu Drucksensoren, elektrischen Impulsen und hochauflösenden bildgebenden Verfahren ausgezeichnet.
Veröffentlicht:
Das Auge unter die Lupe nehmen: Drei Wissenschaftler wurden für ihre Forschung in der Ophthalmologie ausgezeichnet.
© by-studio - stock.adobe.com
München. Den Wissenschaftspreis 2020 hat die Stiftung Auge in diesem Jahr an gleich drei Wissenschaftler verliehen, und zwar an Privatdozent Dr. Philip Enders aus Köln, Dr. Miltiadis Fiorentzis aus Essen und Privatdozent Dr. Simone Tzaridis aus Bonn.
„Dass wir drei Preise verleihen, ist in der Geschichte des Wissenschaftspreises ein Novum“, wird der Stiftungsvorsitzende Professor Frank G. Holz in einer Mitteilung der Stiftung zitiert. „Es zeigt die hohe Qualität der Einreichungen, die allesamt die Diagnostik und Therapie der behandelten Augenerkrankungen deutlich voranbringen“. Der Preis ist mit jeweils 1000 Euro dotiert. Er wurde beim virtuellen Kongress der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) verliehen, zu der die Stiftung Auge gehört, teilt die Stiftung mit.
Privatdozent Dr. Philip Enders von der Universitäts-Augenklinik Köln wurde ausgezeichnet für seine Arbeit zu einem System mit Drucksensor zur drahtlosen Telemetrie-Übertragung, das Patienten mit Hornhautprothese ins Augeninnere implantiert wird. Das System messe konstant den Druck, heißt es in der Mitteilung. Ein langfristig erhöhter Augeninnendruck kann ja den Sehnerv schädigen und zur Erblindung führen. „Die üblichen Messverfahren liefern bei Menschen mit Hornhautprothese keine zuverlässigen Ergebnisse. Dabei leiden Patienten mit einer Keratoprothese nach der Op recht häufig an erhöhtem Augeninnendruck, einem sogenannten Sekundärglaukom“, führt Holz in der Mitteilung aus.
Untersuchungen von Tumoren und Teleangiektasien
Maligne Hauttumoren auf der Aderhaut und der Hornhaut des Auges untersuchte Dr. Miltiadis Fiorentzis von der Augenklinik am Universitätsklinikum Essen. Im Detail prüfte er, wie elektrische Impulse die Wirksamkeit von chemotherapeutischen Medikamenten verbessern könnten. Durch Einsatz eines 3D-Modells einer Tumorzelle und eines Hühnerembryos habe er erkannt, dass sowohl das Wachstum als auch die Zahl von Tumorzellen mit einer Elektrochemotherapie reduziert werden könnten, so die Stiftung.
Hochauflösende bildgebende Verfahren hat Privatdozent Dr. Simone Tzaridis genutzt, derzeit am Scripps Institute in San Diego tätig, um neue Charakteristika der Makulären Teleangiektasien Typ 2 (MacTel) herauszuarbeiten. Sie hat dadurch zum ersten Mal demonstrieren können, wie sich die Gefäße an drei bestimmten Stellen der Makula im Verlauf der MacTel-Erkrankung verändern würden, heißt es in der Mitteilung weiter. „Die Erkenntnisse von Frau Dr. Tzaridis helfen dabei, das Ausmaß der Erkrankung einzuschätzen und eine Prognose zum weiteren Verlauf abzugeben“, wird Holz in der Mitteilung zitiert. (eb)