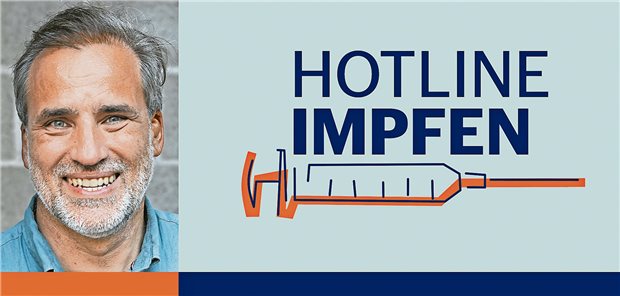Depression und Co.
Junge Frauen sind besonders anfällig
Angst, Stress, Depressionen: Psychische Probleme machen vor allem jungen, armen und einsamen Menschen zu schaffen. Und Burn-out scheint eher eine Erkrankung der Reichen zu sein. Das zeigt eine Studie zur Gesundheit in Deutschland.
Veröffentlicht:
Viele jungen Menschen leiden an prekären Lebensverhältnissen, etwa durch befristete Arbeitsverträge oder unklare Zukunftsaussichten.
© Lyrix / fotolia.com
BERLIN. Wie steht es um die Gesundheit der Deutschen? Sind psychische Erkrankungen tatsächlich auf dem Vormarsch oder werden sie nur häufiger erkannt?
Erste Antworten auf solche Fragen kann nun die "Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland" (DEGS) liefern.
Hierfür befragte man zwischen 2008 und 2011 eine repräsentative Auswahl von über 8000 Erwachsenen nach dem seelischen Befinden.
Zusätzlich untersuchten Ärzte 5300 der Teilnehmer im Zusatzmodul "Psychische Gesundheit" mit validierten Fragebögen auf Erkrankungen nach DSM-IV-Kriterien.
Jeder Zwölfte ist depressiv
Im allgemeinen Teil von DEGS wurden vorwiegend die ärztlichen Diagnosen erfasst. Die ersten Auswertungen hat Dr. Ulfert Hapke vom Robert Koch-Institut in Berlin beim DGPPN-Kongress vorgestellt.
Eine aktuelle Depression haben demnach 8,1 Prozent der Bundesbürger (Frauen 10,2, Männer 6,1 Prozent). Die Prävalenz ist bei den 18- bis 29-Jährigen am höchsten - sie liegt hier bei knapp 10 Prozent. Bei Personen ab 65 Jahren ist sie mit 6,3 Prozent am niedrigsten.
Etwas anders sieht es bei der Lebenszeitprävalenz aus, diese nimmt mit dem Alter zu, erreicht bei den 45- bis 64-Jährigen ihr Maximum (20 Prozent bei Frauen, 10 Prozent bei Männern) und fällt dann wieder etwas ab.
Hapke erklärt die hohe Punktprävalenz der Depression bei jungen Menschen nicht zuletzt auch damit, dass die Lebensverhältnisse bei ihnen oft noch prekär sind, etwa durch unklare Zukunftsaussichten.
Burn-out vermehrt bei Gutverdienern
Ein Burn-out ist dagegen am häufigsten im mittleren Lebensalter zu finden, vor allem bei finanziell gut gestellten Personen: Die Lebenszeitprävalenz ist bei Wohlhabenden mit 5,8 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei finanziell schwachen Teilnehmern (2,6 Prozent).
Umgekehrt hatten 14 Prozent der Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status schon einmal eine Depression, aber nur 4,6 Prozent derjenigen mit hohem Status.
Das, so Hapke, wirft die Frage auf, ob Burn-out für viele Gutverdiener nur ein gefälliges, sozial besser akzeptiertes Etikett für eine Depression ist - nach dem Motto: "Ich habe eben alles gegeben, deswegen bin ich jetzt ausgebrannt".
Wie sieht es nun aber mit der Häufigkeit psychischer Erkrankungen aus, wenn man die Bevölkerung nach den harten Kriterien des DSM-IV beurteilt?
Eine wesentliche Erkenntnis der allgemeinen DEGS-Befragung wird mit dem Modul "Psychische Gesundheit" bestätigt: Es sind vor allem junge Menschen und hier wiederum Frauen, die an psychischen Problemen leiden.
Insgesamt ließ sich bei 27 Prozent mindestens eine psychische Störung innerhalb der vergangenen zwölf Monate ermitteln, 32 Prozent waren es bei Frauen, 21 Prozent bei Männern.
Bei zwei Dritteln der Betroffenen liegen gleich mehrere Störungen vor, berichtete Professor Hans-Ulrich Wittchen von der Technischen Universität Dresden.
Angststörungen am häufigsten
Am höchsten ist die Einjahres-Prävalenz für eine Störung bei den 18- bis 35-Jährigen: 44 Prozent der Frauen und 32 Prozent der Männer sind betroffen, bei den über 65-Jährigen sind es nur 19 Prozent.
Spitzenreiter sind Angststörungen (15,3 Prozent), gefolgt von der unipolaren Depression (7,9 Prozent). Auf Platz drei folgt die Alkoholstörung mit 4,3 Prozent.
Hinweise auf Schutzfaktoren liefert die Studie ebenfalls: Bei Verheirateten liegt die Prävalenz für eine psychische Störung bei 22 Prozent, bei Geschiedenen ist sie doppelt so hoch.
Wer sozioökonomisch auf der Sonnenseite steht, hat psychisch ebenfalls weniger Probleme: Bei 21 Prozent lässt sich eine Störung diagnostizieren, 35 Prozent sind es in den schlechter gestellten Schichten.
Keine signifikanten Unterschiede zeigten sich hingegen zwischen der Bevölkerung in Ost- und Westdeutschland sowie zwischen Stadt- und Landbewohnern.
Prävalenz bleibt konstant
Feststellen lassen sich aber gravierende Auswirkungen auf Fehlzeiten bei der Arbeit: Von den Personen mit einer psychischen Störung in den vergangenen zwölf Monaten hatte sich mehr als ein Drittel im vergangenen Monat krank gemeldet, und zwar im Mittel knapp sechs Tage.
Ohne psychische Störung war nur ein Zehntel krank, und dies mit im Schnitt 3,5 Tagen auch deutlich kürzer.
Die DEGS-Zahlen liegen aber noch immer weit über den administrativen Daten zu psychisch bedingten Fehlzeiten von Krankenkassen.
Wenn also in regelmäßigen Abständen gemeldet wird, dass immer mehr Menschen wegen psychischer Erkrankungen am Arbeitsplatz fehlen, liege das lediglich daran, dass die Fehlzeiten spezifischer als früher auf psychische Diagnosen bezogen werden.
"Es gibt aber keine Zunahme psychischer Störungen", sagte Wittchen. Darauf deuteten Vergleiche mit den Daten des Bundesgesundheitssurvey von 1998 ebenso wie europaweite Analysen.
Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Fakten gegen Kurzschlüsse