Maßregelvollzug: dichtes Netz gegen Rezidive
In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Patienten im Maßregelvollzug auf etwa 9500 verdoppelt. Bei guter Betreuung ist die Rückfallrate nach der Entlassung gering.
Veröffentlicht: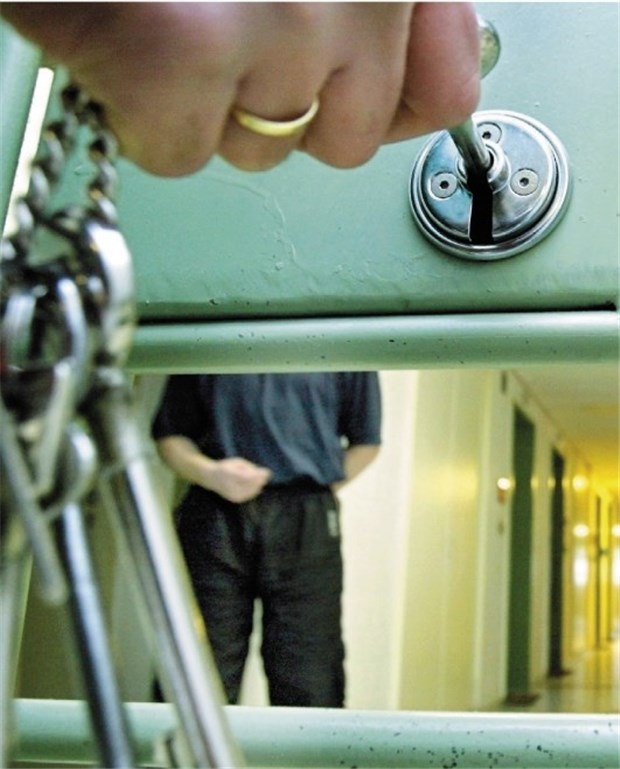
Die Hoffnung auf Freiheit ist für Patienten im Maßregelvollzug realistischer als für Straftäter im normalen Vollzug.
© Foto: dpa
HEIDELBERG. Christian S. ist seit seinem siebten Lebensjahr an einer schizophrenen Psychose erkrankt, als 13-Jähriger durch eine Straftat aufgefallen und mit 17 Jahren zum ersten Mal in einer forensisch-psychiatrischen Abteilung untergebracht worden. Seine Biografie ist eine Geschichte von Fortschritten und Rezidiven. An ihr macht der Arbeitskreis Forensische Psychiatrie Transparent die vielen Stationen einer Rezidivprophylaxe deutlich.
Patienten müssen sich vor dem Ausgang bewähren
Christian S., derzeit in der Klinik für Forensische Psychiatrie am Psychiatrischen Zentrum in Nordbaden (PZN) in Wiesloch, berichtet, dass er wegen Bedrohung von Politikern eingewiesen wurde. "Ich bin sehr krank gewesen, als ich zunächst auf einer geschlossenen Station für sehr gefährliche Patienten untergebracht worden bin", sagt der heute 36-jährige Mann. Nach vier Jahren auf dieser Station habe er festgestellt, dass es für ihn "dort nicht mehr weiterging": "Es gab ungünstige Prozesse in der Gruppe, ich bin in Schlägereien verwickelt worden oder in Aktivitäten wie das Schlucken und Ausspucken von Medikamenten, die anschließend verkauft wurden", berichtet Christian S. Er wird verlegt, kann sich von der Gruppe lösen, und sich verschiedene Stufen des Ausgangs von der Station "erarbeiten", wie er es nennt.
"Es gibt acht Stationen, von der geschlossenen Abteilung bis zum Ausgang in die Stadt in einer Dreiergruppe von Patienten, und diese Stationen sind in allen forensisch-psychiatrischen Zentren ähnlich", sagt Dr. Annette Gerlach, stellvertretende Chefärztin des PZN Wiesloch. Ein multiprofessionelles Team beurteilt in jeder Stufe, ob eine Lockerung möglich ist. Die dem Patienten zugeteilten Bezugspfleger, behandelnde Ärzte, ein Oberarzt und das Chefarzt-Team entscheiden also gemeinsam.
Bei Patienten mit einer schizophrenen Psychose könne es zum Beispiel um die Frage gehen, ob er verheimliche, wenn er Stimmen höre, ob er aggressiv sei, ob er bei der Therapie mitarbeite, Krankheitseinsicht zeige und verstehe, dass er regelmäßig Medikamente nehmen müsse.
Konzept des Stufenplans ist allgemein akzeptiert
Das Konzept des Stufenplans, also der Lockerung mit Belastungserprobung, ist inzwischen allgemeiner Konsens und zum Teil durch Gesetze, zum Teil durch die Aufsichtsbehörden vorgeschrieben. Bei Beurlaubungen muss die Staatsanwaltschaft zustimmen, bei mehr als drei Tagen Urlaub in Hessen auch das Strafvollstreckungsgericht. Lockerungen dienen einem therapeutischen Zweck: der Motivation. Aufgrund solch engmaschiger Therapie- und Sicherheitskontrolle habe es zum Beispiel beim PZN bei etwa 100 000 Lockerungsmaßnahmen im vergangenen Jahr nur 17 "Entweichungen" gegeben, sagt Gerlach.
Eine Entweichung geht aufs Konto von Christian S. Er nutzte einen Ausgang im Park. Nach wenigen Tagen auf freiem Fuß meldete er sich jedoch in der psychiatrischen Abteilung einer Klinik im Rheingau, um Medikamente zu erhalten. Danach kehrte er freiwillig ins PZN zurück.
Lesen Sie dazu auch das Interview: "Lügen bedeutet nicht: schlechte Prognose"





