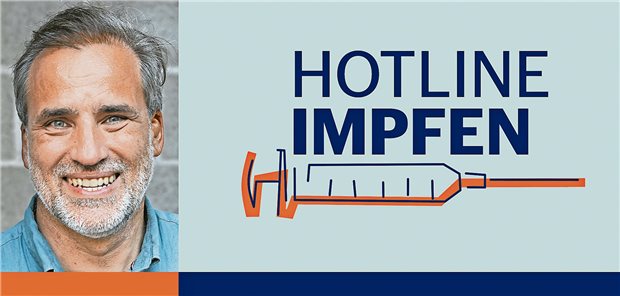Protoporphyrie: Erst juckten die Zehen, dann kamen Ödeme
Ein Mädchen spürte nach Sonnenbädern Brennen, Kribbeln oder Schmerzen in Fingern und Zehen. Außerdem bildeten sich Ödeme an Händen, Füßen und im Gesicht. Als Ursache stellte sich eine erythropoetische Protoporphyrie heraus.
Veröffentlicht:
Hautveränderungen nach Regredienz der Ödeme am Fuß (links) und an der Hand.
© Privatdozent Dr. R. Cremer, Köln
KÖLN. Es gibt viele Krankheiten, die durch Sonnenlicht ausgelöst oder verschlimmert werden. Dazu gehören die Porphyrien. Sie treten teilweise erst im Erwachsenenalter auf, manchmal aber auch bereits in der Kindheit.
So beschreiben Kinder- und Jugendmediziner aus Köln die Krankengeschichte eines zwölfjährigen Mädchens, das seit sieben Jahren immer wieder über Juckreiz, Brennen, Kribbelparästhesien sowie Schmerzen an den Akren klagte - allerdings ohne dass Hautveränderungen sichtbar wurden.
Auffällig war, dass die Beschwerden nur bei schnellem Temperaturanstieg und Sonnenexposition auftraten, berichten Privatdozent Dr. Reinhold Cremer von den Kliniken der Stadt Köln und seine Kollegen (Monatsschr Kinderheilkd 2010; 158: 1203).
Kühlung linderte die Symptome. Nach langer Sonnenexposition schließlich traten erstmals erhebliche Ödeme an Händen und Füßen sowie beginnend im Gesicht auf. Mit oral verabreichten Kortikoiden ließ sich die Progredienz der Symptome nicht aufhalten.
Bekannt ist, dass zum Beispiel Morbus Günther bereits in der frühen Kindheit symptomatisch werden kann. Dabei handelt es sich um die kongenitale erythropoetische Porphyrie, sie wird autosomal-rezessiv vererbt.
Die Häm-Synthese ist aufgrund des genetisch bedingten Enzymdefekts gestört, sodass vermehrt Uroporphyrin I und Koproporphyrin im Urin anfallen. Typische Symptome sind schwere Lichtdermatosen, die Zähne verfärben sich rot, ebenso der Urin. Die Patienten bekommen eine hämolytische Anämie und Splenomegalie.
All diese Symptome und klinischen Befunde waren bei dem Mädchen jedoch nicht vorhanden. Bei ihm handelte es sich um die erythropoetische Protoporphyrie. Protoporphyrin ist ein Derivat des Porphyrins. Protoporphyrin wird nicht in Häm umgewandelt, weil die Aktivität der Ferrochelatase unzureichend ist.
Damit reichert sich Protoporphyrin in Erythrozyten, in Leberzellen und im Blutplasma an. Nehmen die kumulierten Protoporphyrine Licht auf, entstehen unter Abgabe von Energie Sauerstoffradikale, die das Gewebe schädigen und Schmerzen auslösen.
Häufig ist die erythropoetische Protoporphyrie (EPP) asymptomatisch. Bei anderen brennt sofort die Haut, wenn Sonnenlicht darauf fällt, es treten Quaddeln auf, Plaques und Purpura. Vererbt wird die Krankheit autosomal-dominant und autosomal-rezessiv.
Sichern lässt sich die EPP, indem die Protoporphyrine im EDTA-Blut quantitativ bestimmt werden. Bei der beschriebenen Patientin lagen der Anteil an freiem Protoporphyrin und das Zinkprotoporphyrin deutlich über dem Normbereich. Grundsätzlich sollten zudem Urin und Stuhl untersucht werden, um hepatobiliäre Probleme rechtzeitig zu erkennen, so Cremer. Bei dem Mädchen gab es keine Hinweise darauf.
Behandelt werden kann lediglich symptomatisch: durch Meiden von Sonnenlicht und Verwendung von Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor. Bewährt hat sich nach Angaben der Kölner Kinderärzte die Therapie mit Antioxidanzien.