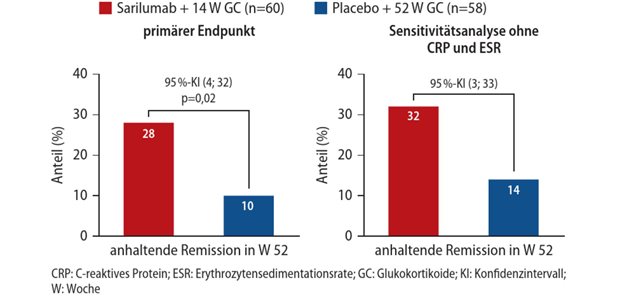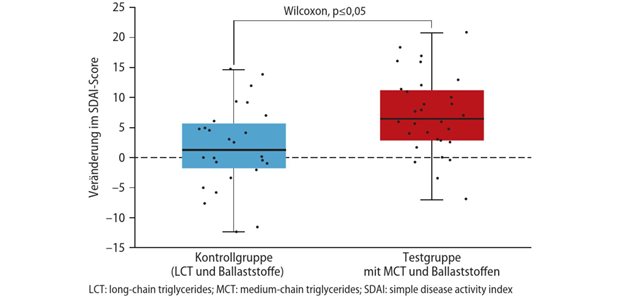Individualisierung statt Standardisierung
Schmerz im Alter – gemeinsam sprechen und handeln
Schmerztherapie im Alter kann eine komplexe Sache und voller Fallstricke sein. Hilfsmittel und Lösungsoptionen gibt es. Man muss sie nur kennen.
Veröffentlicht:
Arzt-Patienten-Verhältnis: Gerade ältere Patienten müssen das Gefühl haben, alles sagen zu können. (Symbolbild mit Fotomodell)
© thodonal/stock.adobe.com
Leipzig. Schmerzen begleiten den Menschen ein Leben lang. Bei älteren und hochaltrigen Menschen jedoch sind insbesondere chronische Schmerzzustände ein quantitativ wie qualitativ anderes Problem als bei jüngeren: Komorbiditäten, die schmerzmodulierend wirken, nachlassende Organfunktionen, die Konsequenzen für die Schmerzbehandlung haben, Analgetika, die in ein polypharmazeutisches Regime integriert werden müssen sowie das damit verbundene Interaktionspotenzial können schmerzmedizinische Stolpersteine sein.
Hinzu kommen Probleme bei der Schmerzerfassung wegen kognitiver Einschränkungen oder die persönliche Einstellung des alten Menschen in Bezug auf Schmerzen, auf die Lebensqualität und auf den Gebrauch von Schmerzmitteln – mit Konsequenzen für die Therapieadhärenz. Ein weiterer Punkt sind die Pflege durch Angehörige und/oder Pflegedienste, die Kommunikation des Arztes mit diesen sowie deren Wissen um Pflege und medizinische Prozeduren.
Permanenter Fortbildungsbedarf
All dies verdeutlicht: in puncto schmerzmedizinischer Versorgung älterer und alter Menschen besteht permanenter Fortbildungsbedarf, weshalb die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS) ihren Schmerz- und Palliativtag 2020 in Leipzig schwerpunktmäßig diesem Thema gewidmet hat. „Wir behandeln das Thema ‚Schmerz im Alter‘ ebenso wie andere schmerzmedizinische Probleme unter dem Dachthema ‚Individualisierung statt Standardisierung‘“, betont DGS-Präsident Dr. Johannes Horlemann, Allgemein- und Schmerzmediziner aus Kevelaer. Soll heißen: In Leitlinien festgehaltene Evidenz ist das Eine, die spezifischen Probleme alter und geriatrischer Patienten das Andere. Gerade im Alter braucht es eher eine individuelle Herangehensweise als das Umsetzen von in Studien definierten Standards.
So bilden Leitlinien den Punkt „Multimorbidität“ kaum ab. Wichtig ist aus oben genannten Gründen bei älteren und geriatrischen Patienten mit Schmerzen eine noch stärker als sonst auf den Einzelnen zugeschnittene Herangehensweise. Dabei müsse dem Willen des hochaltrigen Patienten deutlich mehr Raum gegeben werden, als dies in jüngeren Patientengruppen der Fall sei, fordert Horlemann. Das gelte selbst dann, wenn dieser Wille im Widerspruch zu bestehender Evidenz stehe, ja sogar, wenn sich der Patient dadurch selbst schade.
An diesem Punkt wird deutlich, dass es unter anderem auch um grundsätzliche Haltungen und Werte geht, die es im Praxisalltag durchzuhalten gilt: Trotz des Zeitdrucks muss akzeptiert werden, dass alte Menschen langsamer sind in ihren Bewegungen, beim Sprechen, beim Auffassen von Informationen. Es erfordert Geduld, ein Schmerzproblem tatsächlich vollständig zu erfassen. Sonst komme es schnell zu Missverständnissen, so Horlemanns Erfahrung. Der Schmerztherapeut erinnert, dass das lateinische Wort „communicare“ nicht nur bedeute, gut miteinander zu sprechen, sondern auch gemeinsam zu handeln. „Wenn der Patient das Sprechzimmer verlässt, sollte er einen Handlungsauftrag mitnehmen, den er umsetzen kann. Einen Auftrag, der auch ins soziale Umfeld hineinwirkt mit Hinweisen für die konkrete Umsetzung im Alltag.“
Gespräch gemeinsam mit Ehepartner
Gelingen kann das nur, wenn das konkrete Schmerzproblem umfassend erkannt, die weitere medizinische und soziale Situation bekannt sind. Der DGS-Präsident empfiehlt, Gespräche mit Hochaltrigen möglichst in Begleitung des Ehepartners, der Kinder oder anderer sich kümmernder Personen zu führen. „Nach meiner Erfahrung ist dann die Chance größer, dass ich als Therapeut alles erfahre, was bedeutsam ist und dass tatsächlich umgesetzt wird, was ich empfehle.“
Dabei kann es hilfreich sein, den biografischen Hintergrund und persönliche Einstellungen zu kennen. Manche Menschen meinen, Schmerzen selbst verschuldet und verdient zu haben. Hinzu kommt ein Schamgefühl, besonders bei Tumorpatienten, etwa, weil sie ihre bislang übliche Rolle in der Familie oder im Beruf nicht mehr ausfüllen können. Nicht zu vergessen der affektive Aspekt von Schmerzen: „Trauer, Wut, Scham, Ekel, Mut, Freude – all das muss ein Therapeut ebenfalls erkennen“, so Horlemann.
Das Erkennen von Schmerzen ist bei Demenzerkrankungen ein weiteres, verbreitetes Problem, weil diese Patienten ihre Schmerzen oft nur noch nonverbal kommunizieren können. Es ist vielfach belegt, dass Demenzkranke seltener Analgetika verordnet bekommen als kognitiv Gesunde. Dabei leiden Demenzkranke keinesfalls unter weniger Schmerzen, im Gegenteil: Neurowissenschaftler haben festgestellt, dass die Nozizeption eher verstärkt ist.
PAIC 15 – geeignet bei Demenz und geistiger Behinderung
Schmerzen werden bei Demenzkranken regelmäßig verkannt oder in ihrer Schwere unterschätzt. International existiert inzwischen eine unübersichtliche Zahl von Fremdbeurteilungsskalen, um dem entgegenzuwirken. Ein Großteil der dort aufgeführten Kriterien seien größtenteils unbrauchbar, wie eine deutsche Arbeitsgruppe herausgefunden hat. Inzwischen hat sich allerdings ein „best off“ valider Schmerzindikatoren für die Fremdbeurteilung herauskristallisiert: PAIC 15 (Pain-Assessment in Impaired Cognition-Skala mit 15 Items) hat sich als geeignet für Demenzpatienten als auch für Menschen mit geistiger Behinderung und mit Chorea Huntington herausgestellt.
Bleibt die Frage: Wer macht’s? Experten sagen: Ohne Schulung kaum jemand. Daher ist ein 30-minütiges E-Trainingsmodul mit Online-Videos zusammengestellt worden. So lernen Ärzte und Pflegende rasch, typische Gesichtsausdrücke, Körperbewegungen oder Vokalisationen bei Schmerzen zu beurteilen.
Wenn es schließlich um die angemessene Schmerztherapie hochaltriger Menschen geht, die das viel zitierte bio-psycho-soziale Krankheitsmodell abbilden soll, gilt es wiederum die bestehenden Versorgungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. So kann bei der Auswahl der Medikation und womöglich notwendiger Medikamentenumstellungen die FORTA (Fit for the Aged)-Liste helfen, die auch als App für mobile Endgeräte verfügbar ist. Behinderungs- und Pflegegrade sind zu beachten, sowie gerontopsychiatrische Therapieangebote. Versorgungsmittel sind zu berücksichtigen und Angehörige einzubinden. Und an Unerwartetes zu denken: Manche Schmerzpatienten trinken Alkohol und glauben, dies verstärke den Analgetikaeffekt. Bis zu 40 Prozent der chronisch Schmerzkranken betreiben Beigebrauch komplementärer Mittel, was dem behandelnden Arzt oft nicht mitgeteilt wird, sei es aus Scham oder weil es für nicht relevant gehalten wird.
Gegenseitiges Vertrauen bleibt daher unbedingte Grundlage des Arzt-Patienten-Verhältnisses: Der Patient muss das Gefühl haben, alles sagen zu können, und auf Therapeutenseite braucht es eine gewisse Offenheit gegenüber komplementären Methoden. Noch einmal DGS-Präsident Horlemann: „Ich sage nicht, dass Komplementärmedizin immer wirkt. Aber helfen tut sie schon.“ Das müsse man unterscheiden. „Wer das ablehnt, untergräbt den Wunsch des Patienten nach Autonomie.“