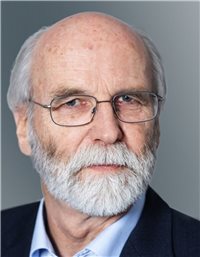Morbus Menière
Steroid hilft so gut wie Gentamycin
Patienten mit Morbus Menière profitieren von intratympanalen Steroidinjektionen so gut wie von Injektionen des Aminoglykosids Gentamycin: Die Zahl der Schwindelattacken innerhalb des letzten halben Jahres eines zweijährigen Follow-up wird gleichermaßen gesenkt.
Veröffentlicht:
Schwindelattacke bei M. Menière: Auch intratympanale Steroidinjektionen sind eine Option.
© ArTo / Panthermedia.net
LONDON. Bisher gab es nur wenige Studiendaten zum Vergleich der Wirksamkeit einer Gentamycininjektion und der einer Steroidinjektion bei Morbus Menière. Zudem fehlten randomisierte kontrollierte Doppelblindstudien.
Einen solchen Vergleich haben jetzt britische HNO-Ärzte um den Neurootologen Dr. Mitesh Patel vom Imperial College in London in einer randomisierten Doppelblindstudie vorgenommen.
Zwei Gruppen mit verschiedenen Injektionsstoffen
Die 60 in zwei gleich große Gruppen aufgeteilten Patienten zwischen 18 und 70 Jahren erhielten jeweils zwei intratympanale Injektionen im Abstand von zwei Wochen, und zwar entweder 62,5 mg/ml Methylprednisolon oder 40 mg/ml des ablativ wirkenden Gentamycins.
Nach den Vorgaben der Leitlinien der American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery wurden bei Patienten zwei Jahre lang regelmäßig Kontrollen vorgenommen. Bisherige medikamentöse Therapien sowie diätetische Maßnahmen wurden beibehalten.
Alle Patienten hatten einen einseitigen Morbus Menière. Innerhalb des letzten halben Jahres vor Studienbeginn mussten sie mindestens zwei Episoden eines Drehschwindels gehabt haben, die mindestens 20 Minuten gedauert hatten, um an der Studie teilnehmen zu können. Außerdem hatten sie auf die Standardtherapie nicht angesprochen.
Primärer Endpunkt der Studie war die Reduktion der Zahl der Schwindelattacken. Sekundäre Endpunkte waren unter anderem die Reintonschwelle und Veränderungen auf der Vertigo-Symptom-Skala.
Patienten, die auf die ersten beiden Injektionen nicht angesprochen hatten, erhielten eine bis zehn weitere Injektionen. Das waren acht Patienten unter Gentamycin und 15 unter der Steroidtherapie.
Schwindel niedriger mit Therapie
Nach Angaben von Patel und seinen Kollegen war die Zahl der Schwindelattacken im letzten halben Jahr vor Ende des Follow-up in beiden Therapiegruppen signifikant niedriger als im halben Jahr vor der ersten Injektion.
In der Gentamycingruppe sank die Zahl von 19,9 auf 2,5, was einer Reduktion um 87 Prozent entspricht. In der Steroidgruppe sank sie von 16,4 auf 1,6, eine Reduktion um 90 Prozent. Die mittlere Differenz errechnete sich zu einem Wert von –0,9.
Der Unterschied zwischen den beiden Therapiegruppen war mit p = 0,51 nicht signifikant. Auch bei allen sekundären Endpunkten, darunter auch das Sprachdiskriminationsvermögen und die Zahl der Schwindelattacken im Monat vor dem Ende des Follow-up (im Vergleich zum Monat vor der ersten Injektion), waren die Ergebnisse zwischen den beiden Therapiegruppen nicht signifikant verschieden.
Gentamycin und Methylprednisolon seien – bis auf leichtere Ohrinfektion – gut vertragen worden (eine versus zwei Infektionen), so die Ärzte. Persistierende Perforationen habe es nicht gegeben (Lancet 2016; 388 ( 10061):2753–2762).
Aufgrund der Ergebnisse ihrer Studie empfehlen die Ärzte, Patienten mit Morbus Menière eine Behandlung mit dem Steroid vorzuschlagen, wenn sie – etwa als Musiker – auf ein exzellentes Gehör angewiesen sind. Im anderen Fall sei eine Behandlung mit dem Aminoglykosid möglich.
90%
weniger Schwindelattacken hatten in einer Studie Patienten mit M. Menière, wenn sie mit intratympanalen Steroidinjektionen behandelt wurden. Bei einer Therapie mit Gentamycin waren es 87 Prozent weniger.