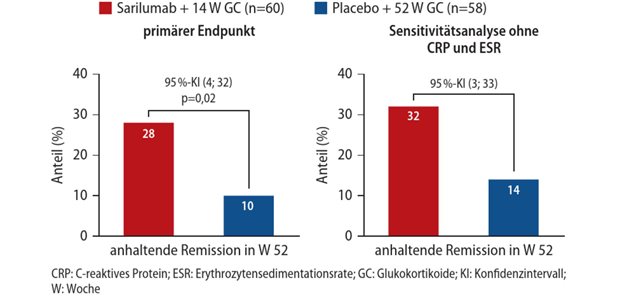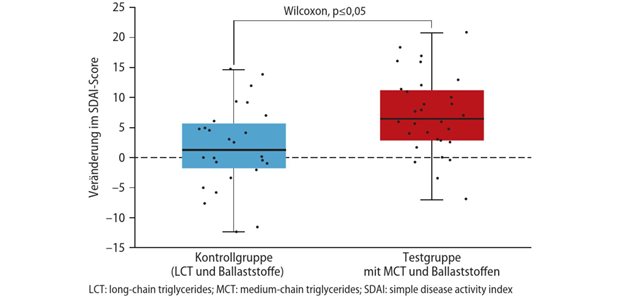Forschung
Stress macht die Knochen morsch
Psychische Belastungen wirken sich negativ auf den Knochenstoffwechsel aus. Dies offenbart eine Studie aus Potsdam.
Veröffentlicht:
Den Stress am besten wegkicken: Gelingt das nicht, kann er offenbar auf die Knochen gehen.
© Andrey Popov / stock.adobe.com
Potsdam. Akuter und chronischer Stress „fährt“ uns langfristig in die Knochen. Zu diesem Ergebnis sind Forscher um Professor Pia-Maria Wippert, Uni Potsdam, gekommen (Psychother Psychosom 2019; online 22. Oktober).
In ihrer Studie wiesen die Wissenschaftler nach, dass sich eine längere physiologische Belastung wie chronischer Stress oder ein frühkindliches Trauma auch Jahre später noch negativ darauf auswirken, wie sich der Knochenstoffwechsel an hohe Stressbelastungen anpassen kann.
In einem ersten Schritt fand das Team anhand von Blutproben aus der Humanstudie DepReha heraus, dass sich der Knochenstoffwechsel während einer akuten Depressionsepisode an die erhöhte Belastung anpasst.
In einem zweiten Schritt stellten die Forscher fest, dass diese Anpassung – unabhängig vom Geschlecht – unterschiedlich stark ausfällt und die Ursachen dafür in der biografischen Belastung einer Person zu suchen sind.
Chronischer Stress mit Folgen
Konkret gibt es bei Menschen mit hoher physiologischer Belastung, etwa durch chronischen Stress, gar keine oder eine nur noch reduzierte anabole Anpassung. Menschen, die ein frühkindliches Trauma erlebt haben, zeigen durch die damit einhergehende höhere Stressreaktivität während einer Depressionsepisode wiederum eine überschießende anabole Reaktion. Bei beiden biografischen Belastungsformen steigt das Risiko einer geringeren Knochenmineraldichte.
„Die Differenzierung einer unterschiedlichen metabolischen Anpassung entlang der biografischen Risikolast wird mit Blick auf Medikation und Therapieformen bedeutsame Konsequenzen in der Behandlung von depressiven Patienten haben“, wird Wippert in einer Mitteilung der Uni Potsdam zitiert. „Die Erkenntnis könnte ein wesentlicher Schritt für die Prävention altersbedingter Erkrankungen wie Osteoporose, Arthrose und Marschfrakturen sein.“
Wippert und ihre Potsdamer Kollegin Professor Karin Würtz-Kozak hatten schon 2015 begonnen, Wechselwirkungen zwischen Depressionen, neuroendokrinen Stressreaktionen und Knochenstoffwechsel zu untersuchen. Bei ersten Knochenmikrostrukturanalysen an Mäusen, die zuvor frühkindlichem Stress ausgesetzt waren, wiesen sie Veränderung der Knochen, etwa bei neuronalen Strukturen, nach. (eb)