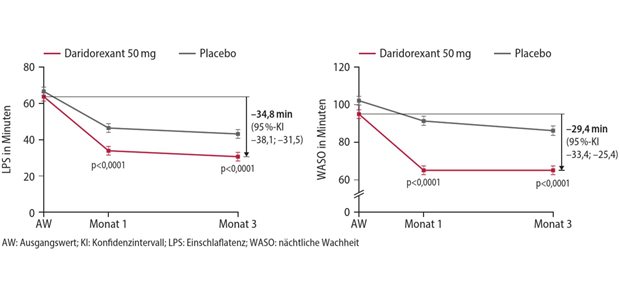Studie bestätigt positive Wirksamkeit
Ecstasy-Wirkstoff MDMA unterstützt PTBS-Therapie
Der Ecstasy-Wirkstoff MDMA verstärkt die Wirksamkeit der Psychotherapie bei Posttraumatischer Belastungsstörung, so eine Studie. In der Schweiz wird MDMA bereits streng reguliert angewandt.
Veröffentlicht:
MDMA in Form von Ecstasy-Tabletten wird häufig in der Party-Szene konsumiert.
© portokalis / stock.adobe.com
Köln. Die Einnahme von MDMA – dem Wirkstoff der Droge Ecstasy – kann die psychotherapeutische Behandlung bei einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) unterstützen. Das bestätigt eine Phase-III-Studie eines Forschungsteams um Jennifer Mitchell von der University of California in San Francisco in den USA (Nature Medicine 2023; online 14. September). Das Besondere: An der Studie nahmen auch Personen teil, die sonst in klinischen Studien häufig unterrepräsentiert sind.
MDMA (3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin) wirkt auf das Serotonin-System des Gehirns. Die Droge fördere unter anderem prosoziales Verhalten, berichtet das „Sience Media Center“ (SMC) in einer Mitteilung. Bereits vor zwei Jahren publizierte das Forschungsteam die Ergebnisse seiner ersten Phase-III-Studie zur Effektivität einer MDMA-unterstützen Psychotherapie bei PTBS (Nature Medicine 2021; 27: 1025). Die Teilnehmenden erhielten dabei über 18 Wochen hinweg mehrere psychotherapeutische Sitzungen. Diese wurden drei Mal entweder mit MDMA oder einem Placebo unterstützt. Die Therapieform war im Allgemeinen gut verträglich und konnte die Schwere der PTBS-Symptome und funktionelle Beeinträchtigungen verringern.
Phase-III-Studie
Ecstasy löscht wohl psychische Traumata
Untersuchung mit vielfältiger Studienpopulation
Häufig sind in klinischen Studien Personengruppen unterrepräsentiert, die ein höheres Risiko haben, eine PTBS zu entwickeln. Dazu zählen zum Beispiel Transgender-Personen, ethnischen Minderheiten, Rettungskräfte, Militärangehörige, Veteranen oder Opfer von chronischem sexuellem Missbrauch. Die Bestätigungsstudie des US-Forschungsteams umfasst daher eine ethnisch vielfältige Population mit mittelschwerer bis schwerer PTBS. Der Ablauf des Experiments ist ähnlich dem der Vorgängerstudie.
Die MDMA-unterstützte Therapie reduzierte die PTBS-Symptome im Vergleich zur Therapie mit Placebo. Am Ende der Studie erfüllten 71 Prozent der Probanden in der MDMA-unterstützten Therapiegruppe die diagnostischen Kriterien für PTBS nicht mehr, gegenüber 48 Prozent der Probanden in der Placebo-Gruppe. Das Studienteam weist darauf hin, dass die Ergebnisse der beiden Zulassungsstudien eine sehr gute Wirksamkeit für den akuten Behandlungsverlauf liefern. Allerdings könnten noch keine Aussagen über einen langfristigen Erfolg der Therapieform getroffen werden.
Indirekte Hinweise auf gute Effektstärke
In einer Mitteilung des SMC kommentiert Professor Matthias Liechti vom Universitätsspital Basel die Studienergebnisse. Nach Ansicht des Stellvertretenden Chefarzts der klinischen Pharmakologie und Toxikologie an dem Spital zeigten die Daten „eine Wirksamkeit, welche im indirekten Vergleich mit anderen bisher verfügbaren Behandlungen – Antidepressiva und Expositionstherapie – aufgrund der Effektgröße klar besser erscheint.“ Somit lägen für die MDMA-Therapie nun potenziell genügend Daten von Patienten für eine Zulassung vor. Allerdings sei es möglich, dass sich nach der in Studien angewendeten Therapie der Zustand im weiteren Verlauf wieder verschlechtern könne und weitere Behandlungen nötig würden, so Liechti. Er verweist auf entsprechende Erfahrungen bei der beschränkten medizinischen Anwendung von MDMA in der Schweiz.
Der Pharmakologe weist darauf hin, dass MDMA in der Schweiz mittels Ausnahmebewilligungen des Bundesamtes für Gesundheit bereits seit acht Jahren außerhalb medizinischer Studien eingesetzt werde. „Diese Behandlung ist aber stark reguliert und auf Patienten beschränkt, die nicht ausreichend auf die üblichen Therapien ansprechen. Zudem muss für jede Behandlung eine Bewilligung durch einen Arzt eingeholt werden und es muss ein Bericht über den Verlauf erstellt werden.“ Nach seinen Angaben wurde MDMA bei PTBS „in Australien zudem im Jahr 2023 neu im Betäubungsmittelrecht reguliert und ist damit für diese spezifische Anwendung nicht mehr verboten. Allerdings wird auch dort die Anwendung stark reguliert und bisher wurden noch keine Patienten behandelt“, so der Pharmakologe. (eb/eis)