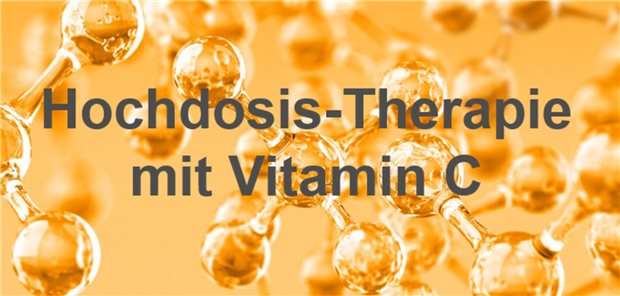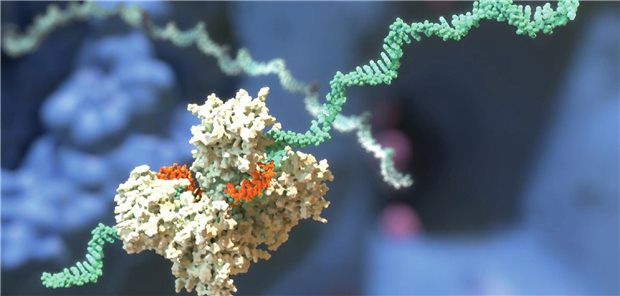Gastbeitrag von Dagmar Röhrlich
Journalismus zwischen Verharmlosung und Alarmismus
In Zeiten von Corona finden wissenschaftliche Debatten in den Massenmedien statt. Virologen werden zu Medienstars: von den einen verehrt, von den anderen gehasst. Wichtiger denn je ist, dass Journalisten vermeintliche Erkenntnisse kritisch hinterfragen und einordnen. Doch das kostet Geld.
Veröffentlicht:
Als Berater der Kanzlerin avancierte der Berliner Virologe Prof. Dr. Christian Drosten zum Medienstar, dessen öffentliche Äußerungen schnell zum Politikum werden können.
© xim.gs / picture alliance
Im November vergangenen Jahres forschten weltweit exakt null Wissenschaftler an COVID-19. Noch ahnte niemand, dass diese Krankheit überhaupt existiert. Gut ein Jahr später, Mitte Dezember 2020, verzeichnet die Metadatenbank PubMed zu COVID-19 mehr als 82 000 wissenschaftliche Aufsätze!
Ein Tsunami an Veröffentlichungen war über die Welt hereingebrochen. Denn SARS-CoV-2 zeigte der Menschheit zum ersten Mal, was eine Zoonose in Zeiten der Globalisierung vermag: Nachdem China zunächst weit weg gewesen zu sein schien und man hierzulande Mitleid empfand für die Menschen, die beim Lockdown in der Elf-Millionen-Stadt Wuhan eingeschlossen waren, explodierten binnen weniger Wochen überall die Fall- und Todeszahlen. Innerhalb eines Jahres erkrankten weltweit mehr als 75 Millionen Menschen an COVID-19, und mehr als 1,6 Millionen Patienten starben daran.

Dagmar Röhrlich
© privat
Am 10. Januar 2020 hatten chinesische Wissenschaftler die vollständige Geninformation des neuen Coronavirus online gestellt – und die Meldung darüber war weltweit gleichzeitig auf den Handys und Computern von Forscherinnen und Forschern erschienen.
Viele von ihnen erinnerten sich dabei an den SARS-Ausbruch 2002/2003, die erste Pandemie des neuen Jahrtausends, welcher 2012 der Ausbruch von MERS-CoV folgte.
Allen Forschern war klar, dass sie es nun mit einem neuen Gegner zu tun haben würden. Nur wie ernsthaft der war, ließ sich noch nicht sagen. Trotzdem schwenkten die meisten Wissenschaftler von ihrer normalen Arbeit auf den neuen Erreger um und widmeten sich COVID-19. Ein paar Tage später setzte der mediale Auftrieb ein.
Zu Beginn der Pandemie war die Faktenlage mangelhaft, doch das änderte sich schnell. Die Erforschung von COVID-19, SARS-CoV-2 und die Entwicklung der Vakzine liefen nicht nur in Rekordzeit ab – sondern erstmals in der Geschichte direkt unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Damit war alles anders. Das Informationsbedürfnis der Bevölkerung war und ist überwältigend. Und es war vor allem zu Beginn der sprichwörtliche Eiertanz, die Menschen für die kritische Lage zu sensibilisieren, ohne in Alarmismus zu verfallen.
Selbst Lokaljournalisten sinnierten über den R-Wert
Spätestens seit der ersten Lockdown-Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt es in den Redaktionen kaum ein anderes Thema als Corona – von einer kurzen Erholungsphase während des Sommers, als die Fallzahlen niedrig waren, einmal abgesehen. Ob die SARS-Pandemie 2002, die Schweinegrippe 2009 oder die Ebola-Epidemie in Westafrika 2014: Die Berichterstattung über sie und das öffentliche Interesse an ihnen verblasst gegen COVID-19.
Hatten Umfragen früher schon ergeben, dass das Vertrauen in die etablierten Medien in Deutschland – trotz aller Debatten über Fake News – schon vor der Krise vergleichsweise hoch war, schien es durch Corona noch zu wachsen: Jedenfalls nahm die Nutzung der traditionellen Medien in den vergangenen Monaten stark zu, wie das „COSMO – COVID-19 Snapshot Monitoring“ der Universität Erfurt zeigt.
In der jüngsten Umfrage wünschten sich beispielsweise die meisten Befragten, über Fernsehen und Radio sowie von ihren Ärzten über die Impfung gegen das Coronavirus informiert zu werden. Aber auch Webseiten und Blogs, die sich mit Corona beschäftigen, erzielen Rekordaufrufe. Virologen sind Dauergäste in den politischen Talkshows.
Und damit hatte das Thema sozusagen das Wissenschaftsressort verlassen, in dem Journalisten darin geübt sind, auf ihrem eigenen Fachgebiet Qualität und Relevanz einer Veröffentlichung einzuschätzen. Es war nun Nummer 1 im Politik- ebenso wie im Wirtschaftsressort, die Vermischtes-Redaktionen griffen es auf, auch die lokalen Journalisten, die noch nie mit Wissenschaft zu tun hatten, beschäftigten sich plötzlich mit 7-Tage-Inzidenz und R-Wert, mit Dynamiken der Verdopplungszeiten, Infektionssterblichkeiten, mit Risiken und Wahrscheinlichkeiten.
Dabei ist der Umgang mit Unsicherheiten, der für die Wissenschaft elementar und selbstverständlich ist, für viele Journalisten, Politiker und für die Gesellschaft durchaus schwierig. Die meisten von ihnen wollen verständliche und eindeutige Aussagen, klare Handlungsempfehlungen – auch wenn die Wissenschaft sie nicht oder noch nicht geben kann.
Wissenschaftler stehen plötzlich selbst im Rampenlicht
In diesem Spannungsfeld finden sich die Forscherinnen und Forscher wieder. Sie mögen es in ihrer Arbeit zwar durchaus gewöhnt gewesen sein, als Experten im Politikbetrieb eingebunden zu werden. Schließlich werden sie gebraucht um zu erklären und aufzuklären – und um Entscheidungen zu legitimieren: als abgesichert durch das Urteil unabhängiger, nicht vom Verwaltungsapparat abhängiger Wissenschaftler. Das entlastet die politischen Akteure. Sie folgen dem Expertenrat – jedenfalls solange er sozusagen ihres Sinnes ist.
Doch in der Pandemie wird die Position der Experten noch einmal eine andere: Sie stehen plötzlich selbst im Rampenlicht. Christian Drosten, Marylyn Addo, Alexander Kekulé, Hendrik Streeck, Sandra Ciesek, Jonas Schmidt-Chanasit – Interviews und Talkshows füllten und füllen ihre Terminkalender: Sie müssen gleichzeitig ihre Forschung mit Hochdruck vorantreiben – und den Dialog mit den Medien pflegen.
Die Wissenschaftler sind plötzlich Teil eines ihnen oft fremden Spiels, dessen Regeln sich auch noch im Laufe der Zeit ändern. In der ersten Phase waren sie vor allem wichtig, um faktenbasiert zu informieren, Objektivität herzustellen.
Später dann sollten sie nicht mehr unbedingt als unparteiische Instanz auftreten, sondern Kontroversen anstoßen. Wobei man nicht verhehlen sollte, dass mancher dies vielleicht hin und wieder auch selbst möchte, schließlich haben auch sie durchaus eigene Interessen, etwa wenn es um Fördermittel geht.
Jedenfalls werden Forscher in der hektischen Coronakrise auch von den Medien instrumentalisiert: Sie sind aus dem quasi geschützten wissenschaftsjournalistischen Zirkel heraus, in dem es um ihre Arbeit geht, und finden sich in einer Arena wieder, in der sie als Person durchaus hochstilisiert werden können, um dann – ebenso wie Politiker – Ziel von Angriffen und Kritik zu sein. Und zwar umso stärker, je näher sie in ihrem öffentlichen Auftreten der Politik kommen. Besonders Christian Drosten zog in seiner Rolle als Berater der Kanzlerin Kritik geradezu an.
Der „Virologe des Vertrauens“ wurde manchen zur Hassfigur
An seiner Person lässt sich sehr gut festmachen, wie schwer der Stand werden kann. Für die meisten ist er der „Virologe des Vertrauens“ – für einige jedoch eine Hassfigur, auf die Polemik und durchaus bösartige Kommentare zielen.
Doch auch seine Rolle als „Virologe des Vertrauens“ birgt Tücken: Jede seiner Äußerung kann ohne Kontext einfach an eine große Öffentlichkeit weitergereicht und sofort zum viel diskutierten Politikum werden. Etwa der Vorschlag, darüber nachzudenken, ob sich die Quarantäne bei Infektionsverdacht nicht unter Umständen verkürzen ließe. Das müsste man erforschen, doch die Emotionen kochten hoch.
Ohnehin ist Forschen unter dem Vergrößerungsglas der Medien und Öffentlichkeit schwierig: So bleibt kaum Raum für die sonst üblichen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen um Daten und Analysen, die vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen in den Laboren, auf Konferenzen und Workshops ablaufen.
Damit kam in der Mediendebatte eine Entwicklung zum Tragen, die in der Physik oder in den Computerwissenschaften schon lange praktiziert wird, in der Medizin und den Lebenswissenschaften aber erst seit wenigen Jahren: die Pre-Prints.
Für die Wissenschaft ist der Vorteil klar: Damit andere möglichst schnell mit neuen Daten und Befunden weiterarbeiten können, werden viele Studien ohne langwierige Kontrollexperimente oder gar Peer-Review auf Pre-Print-Servern veröffentlicht: vorläufige Ergebnisse, die vielleicht wichtig sein könnten oder auch nicht. Hatten sie früher nur Forscherkollegen interessiert und vielleicht ein paar Spezialisten unter den Journalisten, mutierten die auf bioRxiv oder medRxiv veröffentlichten Diskussionspapiere nun zur Informationsquelle für die Medien.
Pre-Prints für Laien schwer zu durchschauen
Das Problem: Für Außenstehende ist es kaum möglich, zu entscheiden, über welche dieser Pre-Prints sich zu berichten lohnt. Viele Journalisten werden dankbar gewesen sein, dass das von der Klaus-Tschira-Stiftung getragene Science Media Center Germany, das zwischen Wissenschaft und Journalismus vermittelt, immer wieder kommentierte Listen über die wichtigsten Vorabdrucke herausbringt.
Vor allen Dingen jedoch mussten Presse und Öffentlichkeit erst lernen, dass es sich um nicht gesicherte Erkenntnisse mit entsprechend eingeschränkter Aussagekraft handelt.
So konnten in den vergangenen Monaten vorläufige Analysen, die sonst im Kollegengespräch „reifen“, verworfen oder bestätigt werden, in der Coronakrise Schlagzeilen machen und kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert werden.
Berühmt-berüchtigte Beispiele sind die Heinsberg-Corona-Studie oder die Erhebungen über die Ansteckungsrisiken durch Kinder. Letztere wurde durch die Mühlen der Boulevardpresse gedreht: Sie hatten deren Interesse geweckt, weil die unklare Infektiosität von Kindern die Gemüter bewegt.
Durch Corona fanden also wissenschaftliche Debatten in den Massenmedien statt, oft unter vereinfachenden oder polarisierenden Überschriften. Die Folge: Es konnte durchaus der Eindruck entstehen, dass sich die Wissenschaftler in grundlegenden Fragen widersprechen oder sich gar streiten. Das jedoch dürfte die Bereitschaft gesenkt haben, die Forschungsergebnisse zu akzeptieren und danach zu handeln.
Und manches erinnerte ja auch wirklich an eine Kakofonie – etwa, wenn es um Sinn oder Unsinn der Maskenpflicht ging, den Nutzen oder Nicht-Nutzen von Alltagsmasken und so weiter. Das wiederum schlägt auf die Glaubwürdigkeit durch, weckt Zweifel und senkt letztendlich die Bereitschaft, sich in Pandemiezeiten zurückzunehmen: Masken zu tragen, zu Hause zu bleiben, Kontakte zu reduzieren.
Fake News verbreiten sich schneller als Wissen
Verstärkt werden kann dieser Effekt über das Internet und die sozialen Medien. So beschrieb die New York Times, wie sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegen die „Infodemie“ (infodemic) zu stemmen versucht, dagegen, dass sich Falschinformationen oder Halbwahrheiten über Virus und Pandemie durchaus schneller verbreiten können als das verlässliche Wissen.
Wissen hat ja – nebenbei bemerkt – immer den klaren „Nachteil“, erst einmal erarbeitet werden zu müssen und von daher langsamer zu sein als jedes Gerücht, das dann auch noch in Alltagssprache in den social media verbreitet wird.
Volker Stollorz, Redaktionsleiter des Science Media Center Germany, macht in diesem Zusammenhang auf das Problem der „motivierten Kognition“ aufmerksam: dass Menschen, selbst wenn sie subjektiv die Wahrheit wissen wollen, doch abwehrend auf neue Informationen regieren können, wenn diese ihre „gefühlten Wahrheiten“ gefährden. Sie suchen die Nähe zu Medien und Gemeinschaften, bei denen sie an ihren Glaubenssätzen festhalten können – manchmal sogar, nachdem sie über einen Irrtum aufgeklärt worden sind.
Oder anders: Sie bleiben am liebsten in ihren Echokammern, in denen sie sich mit ihresgleichen treffen und es sich sozusagen gemütlich machen können.
Stollorz‘ These: In Deutschland war der seriöse Journalismus während der Angst zu Beginn der Pandemie eine Art Anker bei der Informationssuche. Doch mit der Zeit spielten dann Internet und soziale Medien eine immer wichtigere Rolle: Die Menschen glauben, dort relevante Informationen zu finden – und zwar bequem und kostenlos. Das Ausmaß der Desinformation und die Wirkung, die jene entfaltet, unterschätzen sie dabei systematisch.
Forscher-Podcasts sind kein Journalismus
Um der Infodemie durch die sozialen Medien etwas entgegenzusetzen und auch der Berichterstattung vor allem in der Anfangsphase, als die Journalisten noch nicht eingearbeitet waren, nahmen sich einige Wissenschaftler – dankenswerterweise – des Problems über eigene Podcasts oder Blogs an.
Die Kooperationen, die dabei zustande kamen, etwa die zwischen dem NDR und dem Virologen Christian Drosten, sorgen für Reichweite. So entstanden nicht einfach noch mehr Mikroblogs mit ein paar Dutzend oder hundert Followern. Vielmehr wird das, was gepostet wird, millionenfach gelesen.
Doch Holger Wormer, Professor für Wissenschaftsjournalismus an der Technischen Universität Dortmund, merkte in einem Interview mit der Webseite Wissenschaftskommunikation.de an, dass ihm diese Kooperation häufig zu affirmativ sei. „Wenn man einem Forscher einfach eine Plattform zur Verfügung stellt, auf der er seine Sicht der Dinge erzählen kann, dann ist das vielleicht ein lehrreiches Format der Wissenschaftskommunikation, es hat aber nichts mit Journalismus zu tun.“ Kritische Nachfragen und Diskussionen kommen zu kurz, und genau sie machen guten Journalismus aus.
Die Coronakrise hat gezeigt, dass der Journalismus und erst recht der Wissenschaftsjournalismus seiner Aufgabe als Gatekeeper gerecht werden muss: Es geht nicht, einfach weiterzuleiten, was vorgesetzt wird, sondern nach professionellen journalistischen Regeln zu arbeiten, ist ganz zentral, wenn die Glaubwürdigkeit erhalten bleiben soll.
Guter Journalismus kostet
Das Problem: Politische Entscheidungen werden künftig nicht nur in der Coronafrage, sondern beispielsweise auch in der Klimakrise immer häufiger aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse gefällt werden müssen. Das bedeutet auch, dass fundierter Journalismus über Forschungserkenntnisse immer wichtiger wird, denn diese Erkenntnisse müssen transportiert, verstanden und letztlich auch akzeptiert werden.
Diese Gatekeeping-Funktion hat in den vergangenen Jahren leider nachgelassen. Das liegt zum einen daran, dass sich nur noch wenige Naturwissenschaftler für eine Laufbahn im Journalismus entscheiden, was angesichts der schwierigen Aussichten verständlich ist.
Hier zeigt sich das eigentliche Problem: Guter Journalismus kostet. Und in Zeiten, in denen sich das Publikum an kostenlose Angebote im Internet gewöhnt hat, wird die Finanzierung immer schwieriger. Doch die COVID-19-Pandemie wird nicht die letzte gewesen sein – von den vielen anderen Problemfeldern der Menschheit ganz zu schweigen.
Ohne Wissenschaft werden sich die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts auf einer Welt mit bald neun Milliarden Menschen, in einer Biodiversitätskrise und mit einem sich beschleunigenden Klimawandel nicht lösen lassen. Doch Wissenschaft muss auch vermittelt werden. Von neutraler Seite – und mit Sachverstand.
Dagmar Röhrlich ist mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin. 1956 in Aachen geboren, studierte sie Geologie und Geophysik und arbeitete später für den Hörfunk . 1999 erhielt sie den Georg von Holtzbrinck Preis für Wirtschaftspublizistik, 2003 den RWTH-Preis Wissenschaftsjournalismus. Im Wintersemester 2019/2020 hatte Dagmar Röhrlich die Springer Nature Gastprofessur für Wissenschaftskommunikation an der Universität Heidelberg inne.