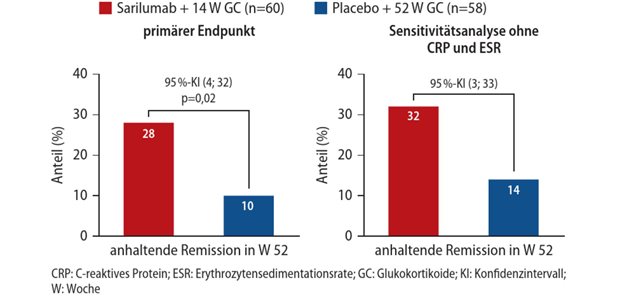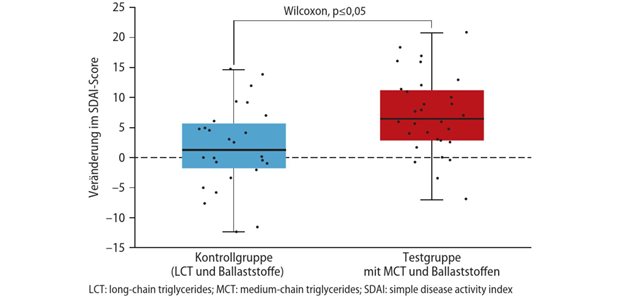„EvidenzUpdate“-Podcast
Scopolamin gegen Todesrasseln – und darf man an Sterbenden forschen?
Röchelatmung ist im Sterbeprozess nicht ungewöhnlich. Eine randomisiert-kontrollierte Studie hat jetzt den Nutzen von Butylscopolamin untersucht. Ein „EvidenzUpdate“ über klinische Studien mit Sterbenden.
Veröffentlicht:
© Springer Medizin
Am Lebensende geht es um das Lindern von Leiden – ärztliche Aufgaben sind dann bekanntlich Palliation, Beistand und Beratung. Letztere besonders auch für die Angehörigen. Was aber, wenn das Sterben zur Qual wird für die Angehörigen? Neben der Seitenlage oder erhöhtem Oberkörper können Anticholinergika das Röcheln lindern und damit die Angehörigen entlasten. Niederländische Palliativmediziner haben jetzt Butylscopolamin s.c. gegen Placebo in einer randomisiert-kontrollierten Studie in mehreren Hospizen untersucht.
Bislang gab es nur wenig Evidenz dazu, deswegen besprechen wir diese Arbeit in dieser Episode vom „EvidenzUpdate“-Podcast. Wir überlegen, welche Rolle die Antiröchelpharmakologie klinisch haben kann und wie sie Teil der Patienten- und Angehörigengespräche sein könnte. Außerdem fragen wir uns, was man von Studien an Sterbenden zum Nutzen Dritter überhaupt halten sollte. (Dauer: 37:37 Minuten)
Anregungen? Kritik? Wünsche?
Schreiben Sie uns: evidenzupdate@springer.com
Transkript
Nößler: Am Lebensende geht es nicht selten um das Lindern von Leiden. Ärztliche Aufgaben sind dann bekanntlich Palliation, Beistand und Beratung. Letztere besonders auch für die Angehörigen. Was aber, wenn das Sterben zur Qual wird, eben auch für die Angehörigen? Darüber, über die Evidenz und die Ethik dazu, darüber wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Evidenz-Update Podcast. Wir, das sind…
Scherer: Martin Scherer.
Nößler: Präsident der deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DEGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Denis Nößler, Chefredaktor der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin nach Hamburg, Herr Scherer. Hallo.
Scherer: Hallo. Moin nach Neu-Isenburg, Herr Nößler.
Nößler: Letzte Episode hatten wir ja das große Vergnügen, dass wir hier im Studio gegenüber sitzen konnten, natürlich mit Plexiglaswand, wie sich das im Moment gehört, weil Sie auf dem Weg zu der Practica waren. Wie war die eigentlich? Ich war ja leider nicht dort.
Scherer: Sehr schön. Sehr schöne Veranstaltung mit einer großen Breite von Themen. Die Allgemeinmedizin oder auch die hausärztliche Versorgung hat ja eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte mit der gesamten Breite dessen, was die Medizin zu bieten hat. Und dementsprechend breit war auch das Referentinnen- und Referentenfeld und dementsprechend viele unterschiedliche Expertinnen und Experten konnte man da treffen. Und es war eine rundum gelungene Veranstaltung.
Nößler: Rundum gelungen, hat sich also gelohnt. Wie war es eigentlich vor Ort? Ich meine, wir wissen ja, es ist immer noch Pandemie. Es gibt Regeln. Wir kennen die Practica. Nicht nur, aber die Practica ist sehr quirliges Erlebnis, wo man zusammenkommt, wo man sich trifft, wo man auch am Abend noch ein Glas Wein an der Bar zusammen trinkt. Wie war das denn dieses Jahr? War das schon wieder richtig Full House, auch mit der Bar am Abend oder gab es da doch Einschränkungen?
Scherer: Das war geordnet und comme il faut, wie man sagt. Also am Anfang war es keine reine 2G-Veranstaltung, weil noch andere Hotelgäste anfangs da waren, aber dann, nach so eineinhalb Tagen, glaube ich, war das dann so, dass es sich um eine geschlossene Veranstaltung handelte mit dem entsprechenden 2G-Nachweis. Und dann hat das auch sehr gut funktioniert.
Nößler: Gut, und die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass es dann vielleicht im nächsten Jahr wieder etwas locker sein KÖNNTE. Wir hatten in dem Podcast-Episödchen vergangene Woche über Insomnien gesprochen. Das war ja auch ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigt haben in Bad Orb, bei der Practica. Wie war das eigentlich mit dem Blick auf dieses Thema? War das jetzt im Podcast schöner oder war es vor Ort schöner?
Scherer: Naja, natürlich ist die Ärztezeitung, die Redaktion der Ärztezeitung der schönste Ort, den man sich vorstellen kann.
Nößler: (lacht) Das wollen Sie mir nicht weismachen. (lacht)
Scherer: Also die Schlafstörungen, die gibt es eigentlich nach der Practica nicht. Das ist so eine dichte Veranstaltung, wo ja noch so viel passiert an Networking, an Personen, die man sonst nur aus Videokonferenzen kennt oder auch nur digital trifft. Und dann kann man natürlich hier noch eine kleine Besprechung und da eine Besprechung machen und dann sind das sehr dichte, intensive Tage, nach denen man hervorragend schläft.
Nößler: Also keine Schlafstörungen nach der Praktika. Das ist dann jetzt mal ein unentgeltlicher Werbeblock für das IHF, nämlich für die nächste Practica. Jetzt wollen wir aber tatsächlich mal so in das Thema einsteigen, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, das wir uns quasi vor die Brust genommen haben. Und zwar geht es über das Sterben. Das habe ich schon angedeutet. Es geht vielmehr auch um den Sterbeprozess und was man in dieser letzten Phase des Lebens tun kann, tun sollte, vielleicht auch einfach unterlassen sollte. Wir wissen, wir sind in einer palliativen Situation an dem Punkt und nicht mehr wirklich im kurativen Bereich. Was mich da zunächst interessieren würde, bis wir dann mal zu der Studie kommen, mit der wir uns beschäftigen wollen heute: Wann ist für Sie denn der harte Cut oder welche Maßstäbe, Kriterien legen Sie denn an, mit dem Sie sagen: „Jetzt habe ich für mich die Erkenntnis gewinnen können: Mit dieser Person geht es jetzt zu Ende“?
Scherer: Nicht mehr essen, nicht mehr trinken, nicht mehr reden. Wenn selbstständige Nahrungsmittelzufuhr nicht mehr möglich ist, wenn auch das Bett nicht mehr verlassen wird und es vom Bewusstseinszustand so ist, dass die Betroffenen nicht mehr ansprechbar sind und in so einem halb somnolenten, semi-komatösen Bewusstseinszustand sind.
Nößler: Wobei wir da wahrscheinlich ja noch mal unterscheiden würden zwischen, ich sage mal, hochaltrigen und jemand, der, keine Ahnung, eher noch jung ist. Wahrscheinlich bei jüngeren Leuten würde man dann eher noch mal in einem intensivmedizinischen Setting versuchen, ob man da nicht noch etwas retten kann.
Scherer: Ganz genau. Aber Sie haben mich danach gefragt, wie man die finale Sterbephase erkennt. Und das sind so die Kriterien eigentlich.
Nößler: Wenn wir jetzt, also gemessen mit diesen Kriterien, die man individuell dann natürlich anlegt, dann tatsächlich zu der Erkenntnis gelangt: Okay, ich habe es jetzt mit dieser Person, mit dieser Patientin, mit diesem Patienten mit jemandem zu tun, der in diesen Sterbeprozess eintritt. Und das gehört einfach zum Leben dazu, das ist dann irgendwann ein Teil, es ist ein Abschnitt unseres Lebens. Vielleicht können Sie noch mal für die nicht ärztlichen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir ja auch haben in dem Podcast, definieren, auch erinnern: Was sind denn eigentlich dann die Therapieziele in dieser Phase?
Scherer: Das Leiden lindern, das Sterben und den Sterbevorgang so zu gestalten, dass er möglichst wenig Leidensvorgänge mit sich bringt und die Begleiterscheinungen des Sterbens nach Möglichkeit reduziert werden. Das heißt, ein ruhiges, leidensfreies Sterben und im Endeffekt den Patientinnen und Patienten oder den Sterbenden das zu ermöglichen, was sich auch jeder von uns eigentlich wünscht: Ein ruhiges, halbwegs beschwerdefreies Einschlafen.
Nößler: Nun haben wir ja dann durchaus eben auch nicht selten die Situation, dass es Momente gibt oder Zeitpunkte in dieser Phase, wo die Person dann nicht mehr ansprechbar ist, sich nicht äußern kann, vielleicht auch kognitiv eingeschränkt ist, Fragen nicht verarbeiten kann und man dann trotzdem irgendwie ermitteln muss: Entsteht jetzt hier gerade ein Leidensdruck? Wie ermitteln Sie das dann? Wie gehen Sie da vor? Ist das eine Intuition?
Scherer: Also vielleicht muss ich erst mal dazusagen, dass ich selber kein Palliativmediziner bin. Ich habe natürlich so eine gewisse Breite der allgemeinmedizinischen Bildung, aber Palliativmediziner bin ich nicht. Ich habe allerdings oft Sterbende begleitet. Auch schon im Studium war ich Sitzwache bei Sterbenden, die keine Angehörigen hatten, habe da oft stundenlang daneben gesessen. Und damals war das schon so, dass sie mich als Studierenden dorthin gesetzt haben, damit ich jemanden holen kann, wenn da irgendwas besonders ist. Wenn plötzlich große Unruhe entsteht, wenn der oder die Sterbende sich bewegt oder plötzlich doch schreit oder etwas passiert, wo man merkt: Hier ist kein ruhiges Einschlafen mehr, hier gibt es vielleicht Schmerzen, Erstickungsgefühle, dem Betreffenden geht es jetzt hier plötzlich nicht gut. Und das sind eben genau die Dinge, also äußere Anzeichen eines Leidens. Die Sterbephase wird ja dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen sich nicht mehr artikulieren können. Und deshalb ist das auch sehr schwer, den Leidensdruck zu ermitteln. Aber es gibt eben, wenn man die Sterbenden gut beobachtet, gibt es strukturierte Möglichkeiten und Symptomskalen, die sich dann dem annähern. Und das ist auch das Gute an der Art der Forschung, die man zu diesem Thema heutzutage machen kann, dass es wirklich Instrumente gibt, die die Möglichkeit bieten, Symptome systematisch zu erfassen. Und diese Instrumente, die finden auch zunehmen Eingang in die palliativmedizinische Forschung. Und das ist genau das, was wir auch gerade am Lebensende brauchen. Da sind sehr gute Studien besonders schwer zu machen, weil man die Betreffenden nicht mehr befragen kann. Umso wichtiger ist es dann, systematische Instrumente zu haben.
Nößler: Also systematisch vorgehen und eben nicht ausschließlich nur nach der Intuition arbeiten, sagen Sie. Jetzt haben Sie die eine Situation oder den einen vielleicht auch eher klassischen Fall schon angesprochen, dass man sich als Beobachter die Frage stellt: Kann da jemand noch normal atmen? Ist da jemand noch in der Lage? Hat er eine Apnoe? Wie ist die Luft? Und dann haben wir die Situation mit der Röchelatmung am Lebensende. Und Sie haben jetzt gesagt, Leidensdruck nehmen. Da ist man dann ganz schnell eben auch bei den Angehörigen. Und wir nähern uns der Studienarbeit, die wir heute besprechen wollen. Heißt Leidensdruck nehmen denn tatsächlich in dieser Phase auch, den Leidensdruck bei den Angehörigen zu nehmen?
Scherer: Das würde ich schon so sehen. Denn es ist ja hier die Frage: Wie will ich den Angehörigen oder den Sterben in Erinnerung behalten? Und die Frage kann man eigentlich nur dann gut beantworten, wenn man wirklich mal stundenlang neben einem Sterbenden oder einer Sterbenden gesessen hat. Das ist eine sehr kontemplative Situation. Da ist ganz viel Trauer dabei, aber da geht man dann oft auch seinen Gedanken nach. Man denkt an die Beziehung zwischeneinander, zueinander, hält vielleicht mal die Hand. Der Sterbende ist sehr für sich. Man selber ist für sich. Dann ist man gedanklich wieder beieinander. Wenn diese Situation begleitet wird von einer ständigen Rasselatmung, dann ist das das Einzige, was man dann da hört. Man nimmt nicht mehr viel wahr. Es wird sich nicht mehr viel bewegt. Es werden sonst kaum Geräusche gemacht. Es wird sich kaum auch noch bewegt. Und dann hört man eben die ganze Zeit diese Rasselatmung. Und da kann ich ganz persönlich sagen als jemand, der das sehr oft oder relativ oft erlebt hat: Das stört einfach, weil das doch auch Aktionen triggert. Man weiß natürlich, es handelt sich um Mucus, der in den Atemwegen ist, der dann da auf und ab tanzt, weil er eben nicht mehr abgehustet werden kann oder auch nicht mehr runtergeschluckt werden kann. Das ist ja genau das Kriterium für eine Sterbephase: Ich bin so schwach, dass ich das Zeug nicht mehr raushusten kann und auch nicht mehr runterschlucken kann. Und das stört einfach. Das kann jemand, der medizinisch vorgebildet ist, sich dann rational erklären, aber es gibt auch Angehörige und auch Studien, die gezeigt haben, dass das Pflegekräfte belastet. Und auch ein Systematic Review aus dem Jahr 2014 hat gezeigt: Über siebentausend Betroffene. Das tritt auch relativ oft auf, in 35 Prozent der Sterbenden. Also das ist schon ein Thema, wo man sagt: Ja, hier geht es mehr um die Angehörigen. Die Sterbenden selber, genau wissen wir es nicht, aber gehen sehr stark davon aus, dass denen das nichts ausmacht, sodass man dann schon sagen muss: Okay, wie gehen wir damit um? Und im Grunde genommen gibt es nur einen Weg, damit umzugehen: Dass man zu Lebzeiten sich Gedanken darüber macht, also dass wir uns überlegen: Wie wollen wir das haben? Und wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, hoffentlich noch viele Jahre hin, ich liege irgendwann im Sterben, meine Kinder halten mir vielleicht die Hand oder auch andere Angehörige, vielleicht auch die Enkel, dann hätte ich gerne, dass das ruhig stattfindet. Also das ist im Grunde genommen eine Frage, die man zu Lebzeiten klären würde oder klären müsste. Und wenn man mich persönlich fragt: Möchtest du ein Medikament haben, dann subkutan gespritzt beispielsweise, das dieses Geräusch dann lindert, um auch gegenüber den Angehörigen diese Situation so angenehm wie möglich zu gestalten, dann würde ich zu Lebzeiten mich wahrscheinlich dafür aussprechen. Aber das wäre ja eine Frage, die man im Kontext mit Patientenverfügung, mit Vorsorgevollmachten eigentlich klären könnte oder mit Eingang in ein Hospiz.
Nößler: Also dass man es dann thematisiert, nicht? Also dass man entweder, wenn man in das Hospiz kommt das bespricht, da müssten wir jetzt tatsächlich dann mal Palliativmediziner dazunehmen, die uns ein bisschen auch erzählen können: Machen sie das vielleicht eh schon? Wird das da regelmäßig thematisiert? Aber wenn ich das jetzt mitnehme, dass Sie sagen: Naja, Patientenwunsch, auch Angehörigenwunsch, das kann sich ja finden in der Patientenverfügung. Dann kann das auch schon ein Tipp auch Richtung Ihrer Kollegen sein, das durchaus auch hier und da mal zu thematisieren bei Patienten, die man ohnehin betreut, dass einfach auch mal, wenn es passt, wenn es einen Zeitpunkt gibt, zu erwähnen: „Bereite dich vor. Das könnte so und so aussehen“, oder?
Scherer: Wenn das eh schon gemacht würde, wie Sie es für möglich halten, das würde mich schon sehr wundern, denn im Augenblick fehlte ja die Evidenz dafür, dass beispielsweise Butylscopolamin wirksam diese Atemgeräusche unterdrückt. Im Augenblick hatten wir Beobachtungsevident und heute reden wir über ein wirklich hochwertiges Stück, das Belege dafür liefert, dass man sagen kann: Ja, das ist eine wirksame Möglichkeit, diese Atemgeräusche zu verhindern. Das heißt, ab jetzt wäre es sozusagen möglich, zu sagen: Nachdem wir diese Wirksamkeitsbelege, wir werden wahrscheinlich gleich noch über die Endpunkte der Studie sprechen, nachdem wir jetzt diese Wirksamkeitsbelege haben, lohnt es sich wirklich, darüber Gedanken zu machen.
Nößler: So, Herr Scherer, und dann sind wir nämlich direkt in der Arbeit drin, mit der wir uns beschäftigen wollen: Wirksamkeitsbeleg zum Thema Butylscopolamin. Ist natürlich, wie immer, alles verlinkt, auch den Review, den Sie erwähnt haben von 2014, das verlinken wir auch in den Shownotes. Eine Arbeit aus den Niederlanden ist das, mit der wir uns beschäftigen, Autorengruppe. Die haben eine multizentrische RCT gemacht, randomisiert kontrollierte Studie in Hospizen, ich glaube, es waren sechs an der Zahl. Eben dort getestet bei Sterbenden: Butylscopolamin gegen Placebo. Und die Nullhypothese von denen wäre jetzt, dass das Anticholinergikum eben die Röchelatmung, das Todesatmen nicht reduziert, Herr Scherer. Das ist die Arbeit, die Sie angesprochen haben. Und da haben Sie schon gesagt: Wir haben da jetzt Evidenz. Was haben wir denn da für Evidenz jetzt?
Scherer: Es sind im Endeffekt relativ wenig Patienten. Wenn man nicht wie, wie aufwendig solche Studien sind, kommt einem das als eine sehr kleine Fallzahl vor. In beiden Gruppen waren es siebzig Patienten. In der Butylscopolamin-Gruppe waren es 79, in der Placebo-Gruppe 78 Patientinnen und Patienten. Und die erhielten entweder eine Placebo-Injektion oder eine Butylscopolamin-Injektion. Dazu muss man sagen, Butylscopolamin gibt es auch noch als transdermales Pflaster. Das ist dann eine Substanz, die die Bluthirnschranke überwinden kann, das subkutane Butylscopolamin eher nicht. Das hat zum Beispiel Implikationen für die Anwendbarkeit der Ergebnisse in den USA, denn da ist das subkutane Butylscopolamin nicht zugelassen. Da gibt es nur das transdermale, das die Bluthirnschranke überwindet. Sie haben es schon gesagt, die primäre Endgröße war die terminale Rasselung. Da gab es die so genannte Back-Skala. Das ist eine vierstufige Skala, die geht von null bis vier. Null ist überhaupt gar kein Geräusch. Eins bedeutet ein patientennahes Rasselgeräusch. Zwei, man hört das Geräusch am Bettende. Drei, man hört es an der Tür. Also eine vierstufige Skala. Und der sekundäre Endpunkt war: Wie lange dauert es denn, bis so ein Geräusch auftritt und was sind sozusagen die Adverse Events? Wir wissen ja, dass Scopolamin dann auch bestimmte unerwünschte Arzneimittelwirkungen machen kann: Unruhe, Mundtrockenheit und andere Dinge bis hin zum Harnverhalt natürlich, der eine gefürchtete Komplikation ist.
Nößler: Also tatsächlich systemisch wirkt, nicht nur im ZNS, sondern dann die typischen anticholinergen Mechanismen entfacht.
Scherer: Ganz genau.
Nößler: Und was kam tatsächlich jetzt in dieser Arbeit knapp 160 Leuten raus? Was haben Sie gefunden?
Scherer: Dass in der Placebo-Gruppe dieses Rasselgeräusch doppelt so häufig war als in der Scopolamin-Gruppe. Natürlich guckt sich der geneigte Studienleser dann die Inclusion Criteria beziehungsweise die Baseline Criteria der einzelnen Gruppen an und sieht da natürlich: Da waren in der Placebo-Gruppe mehr Raucher. Da waren mehr mit Lungenkrebs. Vielleicht muss man da auch noch mal dazu sagen: Es ist unglaublich schwer, eine solche Studie zu machen und deshalb gibt es davon auch so wenig und deshalb ist diese Studie jetzt auch erst mal wirklich das beste Evidenzstück, was wir zu diesem Thema haben. Also die sind in sechs Hospize reingegangen. Da gibt es dann natürlich auch kleine Cluster-Effekte. Ein Hospiz hat überproportional viele Patientinnen und Patienten eingeschlossen. Wer mal solche Studien gemacht hat weiß, wie schwer das ist, denn man muss die Patientinnen und Patienten ja A in einem wachen Zeitfenster noch erreichen um ein Informed Consent machen zu können. Und dann kann es natürlich auch passieren, man macht den Informed Consent und was natürlich dem Betreffenden dann zu wünschen ist, zieht sich das noch sehr, sehr lange hin. Das heißt, es dauert dann auch sehr lange, bis man diese Fallzahl von Patientinnen und Patienten zur Verfügung hat. Aber diese Studie zeigt: Man kann es machen. Man kann solche Studien durchführen. Man kann solche Patientinnen und Patienten rekrutieren und vor allem: Man kann dann auch diese Symptomerfassung systematisch machen und löst dadurch eben genau das Problem, was Sie anfangs auch thematisiert haben: Was fühlen die denn? Leiden die Betroffenen vielleicht noch? Das kann man durch eine systematische Beobachtung zumindest annäherungsweise rauskriegen.
Nößler: Jetzt haben Sie schon über die Baseline Criteria der 160 Patienten gesprochen und haben festgestellt, dass in der Placebo-Gruppe mehr Raucher waren, ich glaube, auch mehr Menschen mit COPD, nicht?
Scherer: Ja.
Nößler: Kann das die Aussage, also Sie haben gesagt, in der Verum-Gruppe, also mit Butylscopolamin subkutan, trat das Röcheln nur bei halb so vielen auf, also 13 versus 27 Prozent. Das war wohl signifikant. Kann dieser Unterschied in der Patienten- Probandenzusammensetzung tatsächlich dann die Aussagekraft dieses Ergebnisses beeinflussen oder wie würden Sie einschätzen, beeinflusst es das?
Scherer: Es ist eine Limitation. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Ergebnisse auch dann noch signifikant gewesen wären, wenn das an dieser Stelle ausbalanciert worden wäre. Wäre es möglich gewesen, hätte man das sicher getan. Das ist einfach das Problem bei kleinen Fallzahlen. Bei größeren Fallzahlen verteilt sich das dann relativ gleich. Das kommt einfach manchmal vor. Was eine wichtigere Limitation dieser Studie ist, ist die Tatsache, dass Patienten mit respiratorischen Erkrankungen und auch Sterbephase aufgrund einer respiratorischen Erkrankung nicht Teil der Studie waren. Also Somnonie-Patienten beispielsweise, wo das ja noch mal ein sehr viel stärkeres Thema ist, die waren eben ex ante ausgeschlossen von dieser Studie. Das heißt, man hat erst mal eben die Gruppe so gestaltet, dass man Erkrankungen, die zu einer massiven Mucus Produktion führen, erst mal nicht dabei hat. Also Raucher, und dahin zielt ihre Frage, Raucher und Bronchialkarzinompatienten haben da natürlich eine stärkere Produktion von Sekret. Das ist aber noch mal etwas anderes, als wenn ich jetzt wirklich auch die Pneumonie-Gruppe dabei hätte oder Ex-Raucher oder Covid-Patienten. Also die waren alle ausgeschlossen, die mit respiratorischen Erkrankungen.
Nößler: Gut. Das heißt, also es gibt ja auch so eine, ich sage mal, gewisse Absaugindikation und dann welche, wo das eher kontraindiziert ist, weil es die Mucus Produktion eher anregt. Wenn wir an der Stelle so ein Zwischenfazit mal einziehen, Herr Scherer, dann kann man an der Stelle sagen: Also es gibt Evidenz für Menschen im Sterbeprozess, die NICHT eine Pneumonie oder eine andere respiratorische Erkrankung haben, dass Scopolamin subkutan das Rasseln reduziert, das Auftreten des Rasseln in der Häufigkeit und im Zeitpunkt verändert. Und dass damit ein Stück weit der Leidensdruck eventuell bei den Angehörigen reduziert werden könnte. Kann man das so sagen?
Scherer: Das kann man schon sagen. Wenn Rasseln auftritt, tritt es später auf als in der Nicht-Scopolamin-Gruppe. Und dann Dinge wie Ruhelosigkeit, Mundtrockenheit, Harnverhalt, die waren auch nicht häufiger als in der Placebo-Gruppe. Also man kann es machen, aber es gibt eben noch einen anderen Haken bei dem Ganzen: Die Sterbephase dauert länger. Und da wäre dann natürlich auch die Schwierigkeit für mich, abzuwägen: Was ist mir jetzt lieber? Eine längere, ruhige Sterbephase oder eine kürzere mit Rasselgeräuschen? Das kann man wahrscheinlich nicht unbedingt klar beantworten.
Nößler: Machen wir es mal in Zahlen. Also was die da im Mittel errechnet haben ist, unter Verum 42 Stunden, unter Placebo dreißig Stunden Dauer der Sterbephase von den Autoren ermittelt. Das heißt, unter Butylscopolamin subkutan dauert dieser Sterbeprozess einen halben Tag länger. Das ist eine Nummer, oder?
Scherer: Ich kann es Ihnen nicht sagen, ob das eine Nummer ist. Denn was Ihrer Frage implizit innewohnt ist ja die Annahme, dass das dann auch eine Vergrößerung des Leidens bedeutet. Das wissen wir aber nicht. Und wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich ist es im Endeffekt für die Sterbenden ohne weitere Auswirkungen, ob das jetzt ein paar Stunden länger dauert oder nicht. Also das muss man einfach wissen und abwägen, wenn man diese Studienergebnisse/ Die Sterbephase dauert etwas länger, ist dafür ruhiger. Wieder individuelle Reflexion: Wenn Sie mich fragen würden, was wäre mir als Sterbender lieber? Ich würde das in Kauf nehmen, dass die Sterbephase dann ein wenig länger dauert.
Nößler: Es könnte ja auch, Herr Scherer, wenn man es dann tatsächlich mit den Angehörigen, vielleicht sogar mit dem Betroffenen, im Vorfeld individuell bespricht, könnte das natürlich ein, ich sage mal vorsichtig diesen Begriff Benefit in den Mund genommen. Es könnte ja auch ein Benefit sein, wenn man sagt, die Abschiedsphase wird länger. Auch das ist ja durchaus eine Option, die manchmal relevant werden kann.
Scherer: Ganz genau, auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir eine Sache noch gar nicht besprochen.
Nößler: Oha.
Scherer: Wir müssten noch mal über die nichtpharmakologischen Möglichkeiten reden. Es gibt ja auch Lagerungsmöglichkeiten, zum Beispiel Oberkörperhochlagerung, Seitenlagerung und dann eine sehr beliebte nichtpharmakologische Therapie ist die der Aufklärung. Das wäre ja auch noch mal eine Möglichkeit, dass man eine Studie macht, wo man/ Und ich weiß wirklich nicht, ob es die gibt. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt nicht noch mal systematisch geschaut: Wenn man einfach die Angehörigen aufklärt und sagt: Das und das wird auf Sie zu kommen. So und so hört sich das an. Das sind Rasselgeräusche, die normal sind, die zu einem Sterbeprozess dazugehören. Das bedeutet nicht, dass Ihr Angehöriger da am Leiden oder am Ersticken ist. Da könnte man eine Interventionsstudie machen, wo man die eine Gruppe so lässt, wie sie ist, die eine Angehörigen. Und bei der anderen Angehörigengruppe dann ein systematisches Aufklärungsgespräch macht oder eine wie auch immer geartete Aufklärungsintervention und dann aber als Endpunkt dann die Befindlichkeit der Angehörigen anschaut und sie dann nach dem Sterbeprozess noch mal befragt: Wie war das jetzt für Sie? Wäre auch noch mal eine Möglichkeit. Oder man macht noch mal eine Vergleichsstudie: Einen Arm Placebo, einen Arm Butylscopolamin und der dritte Arm hat Lagerungsmanöver. Es wäre auch eine vierarmige Studie denkbar, wo dann im vierten Arm die Aufklärung der Patienten drin ist. Also es ist da noch nicht zu Ende geforscht. Die Studie zeigt, dass es möglich ist, solche Studien zu machen, aber sie sind sehr aufwendig.
Nößler: Also Sie haben jetzt schon die Idee geliefert für eine mehrarmige RCT, die verschiedene Techniken vergleicht miteinander und dann am Endpunkt, nämlich: Wie geht es dir als Angehöriger? Da müsste man sicherlich strukturierte Fragebögen entwickeln, aber auch mit dem Hinweis: Naja, das sind so Studien, die macht man nicht aus dem Lameng. Das haben Sie auch eingangs schon gesagt.
Scherer: Ja. Aber die muss man nicht entwickeln. Da muss man sich nur die Endpunkte überlegen. Man kann nach der psychischen Belastung fragen, nach posttraumatischer Belastungsstörung. Dafür gibt es ja validierte Instrumente, die liegen vor. Nur die Auswahl der Endpunkte, die müsste man sich dann gut überlegen.
Nößler: Wenn wir an der Stelle/ Ich will gleich noch mal auf etwas Prinzipielles zu sprechen kommen. Wenn wir an dieser Stelle aber mal zusammenfassen: Sie haben gesagt, also wir haben gesehen, Butylscopolamin subkutan kann das Röcheln in der Häufigkeit und in der Zeit des Auftretens signifikant verändern. Das kann Vor- und Nachteile haben. Das ist jetzt ein Evidenzstück, das für das ärztliche Gespräch hinzukommt, für die gemeinsame Entscheidungsfindung. Was nehmen Sie aus dieser Arbeit an klinischem Impact, sage ich mal, für sich mit? Wie würden Sie für sich die Kenntnis über diese Studie im Zweifel jetzt auch einbauen?
Scherer: Man kann die Angehörigen besser aufklären und vielleicht sogar die Betroffenen. Die Herbstphase, Oktober, spätestens November ist dann natürlich auch immer der Zeitpunkt, wo man über den Tod nachdenkt. Und da kann es schon sein, dass Patientinnen und Patienten auf einen zu kommen. Das heißt, man kann sie einfach besser beraten und man kann Angehörige besser beraten. Man kann ihnen sagen, es gibt eben Belege dafür, dass man durch eine subkutane Injektion den Sterbevorgang leiser machen kann. Und das nehme ich eigentlich da raus, mit aus dieser Arbeit, dass ich einfach einen Baustein für die evidenzbasierte Patientenberatung mehr habe.
Nößler: Also ein Fragezeichen ist kleiner geworden und Sie haben mehr Dinge, über die Sie aufklären können. Jetzt will ich zum Ende mit Ihnen noch über zwei ganz grundsätzliche Dinge sprechen, nämlich auf der einen Seite mal über die Frage, inwieweit die Intervention bei einer Person für den Nutzen einer dritten Person denn ethisch vertretbar ist. Das ist der eine Aspekt. Und dann hinten raus die Frage, wie das generell eigentlich ist mit klinischen Studien AN Sterbenden, also ich betone ganz bewusst AN sterbenden Menschen. Probieren wir es mal mit dem ersten Thema. Also wir haben hier in dieser Intervention bei sterbenden Menschen das Rasseln gelindert. Sie hatten schon gesagt, man geht davon aus, dass diese Rasselgeräusche nicht mit Leiden einhergehen, wie gesagt: Man geht davon aus. Es geht hier tatsächlich auch, das ist ein wesentlicher Aspekt, sagen ja die Studienautoren auch selbst, um die Entlastung der Angehörigen, die diesen Sterbeprozess begleiten. Was ist denn grundsätzlich davon zu halten, dass wir klinische Interventionen, hier die Pharmaka-Gabe, machen zum Nutzen von Dritten?
Scherer: In dem Fall würde ich sagen, davon ist durchaus etwas zu halten. Denn wenn man die Betroffenen fragt, die schwer krank sind, dann wollen die in der Regel ihren Angehörigen nicht zur Last fallen. Das ist auch zum Teil ein Autonomiegedanke. Zum Teil hat es auch mit Würde zu tun, aber zum anderen Teil ist es auch, dass sie sagen: Ich möchte niemandem mehr als nötig zur Last fallen. Deshalb, wenn man mit Betroffenen darüber spricht, sie darüber aufklärt, dass es diese Geräusche geben kann, sie darüber aufklärt, dass das auch sowohl die Pflegenden als auch die Angehörigen belasten kann, dann bin ich mir relativ sicher, dass die meisten dann sagen würden: Ja, ich möchte da gerne einen möglichst ruhigen Sterbevorgang haben. Das ist auch für mich, ich habe es eben für mich persönlich schon beantwortet: Das gehört für mich auch zu einem Sterben dazu, wie ich mir das persönlich wünsche. Und der Weg dahin ist, den Betroffenen nach Möglichkeit zu fragen. Ich nehme auch noch mal mit, dass wir das vielleicht auch noch mal beforschen. Vielleicht machen wir da auch noch mal ein Survey zu, zu diesem Thema. Man kann das ja wirklich auch, diese Patientenperspektive, auch diese Patientenpräferenzen, über die wir hier letztlich reden, die kann man ja auch noch mal mit Evidenz anreichern und auch noch mal ein bisschen genauer gucken, nachdem wir jetzt dieses Evidenzstück haben: Wie viele würden das denn eigentlich wollen? Wie viele würden das denn machen? Denn das ist im Grunde genommen der Weg dahin, dass man die Angehörigen von den Betroffenen nicht künstlich abtrennt gedanklich, sondern sagt: Die sind doch beziehungsmäßig sowieso so eng miteinander verbunden, dass die eine Präferenz und die andere Präferenz doch sehr stark miteinander zusammenhängen.
Nößler: Das zu erforschen könnte ja durchaus auch ein interessantes Thema mal für eine Doktorarbeit sein.
Scherer: Ja, also so aufwendig, wie diese Studien sind, muss das wahrscheinlich dann ein bisschen größer angelegt sein. Das kann man wahrscheinlich nicht auf den schwachen Schultern einer Dissertation austragen. Aber wahrscheinlich eine Arbeit, in der man dann auch verschiedene Dissertationen unterbringen kann.
Nößler: Dann nehme ich an der Stelle tatsächlich mal mit: Intervention bei einer Person zum Nutzen dritter, klar, müssen wir hier wahrscheinlich groß auswalzen, ist zumindest immer erst mal mit einem großen Vorsicht ausgerufen, aber kann hier einen echten Nutzen haben, eben auch aus Sicht derjenigen, bei denen diese Intervention stattfindet. Und da sehen Sie tatsächlich auch einen Anlass für Forschung. Mal grundsätzlich, wir reden ...
Scherer: Weil die Präferenzen zwischen Angehörigen und Betroffenen oft ein Kontinuum darstellen und weil die sich nicht so in verschiedene Töpfchen sortieren lassen.
Nößler: Richtig, also nicht A versus B, sondern es ist eine gemeinsame Sache. Mal grundsätzlich, das ganze Leben ist heilig, müsste man ja eigentlich konstatieren. Aber nun ist auch gerade der letzte Abschnitt des Weges, den wir im Leben verbringen ganz besonders sakrosankt und eigentlich auch mit höchstmöglicher Würde ja umzusetzen. Da stellt sich dann die Frage: Wie ist es denn grundsätzlich eigentlich mit klinischen Studien bei Sterbenden? Sie haben schon gesagt, das ist eh schwierig, die Leute zu rekrutieren. Ist das ein grundsätzliches Tabu? Kann ich mir ja nicht vorstellen. Die Ethikkommission hat das ja genehmigt. Aber geht man da nicht tatsächlich wirklich mit extremen Samthandschuhen dran?
Scherer: Man muss das mit Bedacht machen, mit Vorsicht, Einfühlungsvermögen und Anstand. Man darf die Würde des ganzen Sterbevorgangs oder der Situation nicht stören. Es sind hohe kommunikative Anforderungen, auch Anforderungen an den so genannten Informed Consent und deshalb sind diese Studien eben auch so aufwendig und so schwierig, weil man die Patienten ja oft dann auch nicht in einer Situation erreicht, wo man das noch gut mit ihnen besprechen kann. Aber diese Studie, die wir heute beredet haben, die zeigt, dass es möglich ist.
Nößler: Gut. Ein Herr Scherer, der jetzt nicht sagt: „Oha, was eine fürchterliche Arbeit“, sondern der sagt: „Ja, natürlich, man geht mit Würde vor bei diesen Themen und diese Studie gibt uns tatsächlich einen Input für unsere klinische Arbeit, damit kann man weiterarbeiten.“ An der Stelle, Herr Scherer, zunächst mal allerbesten Dank für die Einordnung dieser Arbeit, die nicht ganz easy ist. Wir sind an dem Punkt, dass wir es wieder mit dem Cliffhanger versuchen müssen, dass wir den Hörern noch mal sagen, dass sie sich an evidenzupdate@springer.com wenden können mit ihren Fragen und ihren Anregungen. Aber jetzt an dem Punkt muss ich Sie fragen, Herr Scherer: Was könnte denn ein Cliffhanger für die nächste Episode werden?
Scherer: Auch da würde ich sagen, stellen Sie sich vor, Sie hingen an Ihrer Klippe: Was ist Ihre letzte Frage? Und die letzte Frage wäre: Kommt jetzt einer, zieht mich hoch? Wenn er mich dann hoch zieht, wie wird dann eigentlich der Corona-Winter und der Corona-Herbst? Das würde ich mich fragen oder würden Sie sich vielleicht fragen, wenn Sie da hängen.
Nößler: Da fallen mir noch ganz andere Fragen ein. Aber wir machen uns Gedanken über die Fragen und werden diese Fragen auch stellen. Herr Scherer, vielen Dank an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen gute Tage, eine gute Woche. Bleiben Sie fröhlich und gesund und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
Scherer: Danke, ebenso, bis bald.
Nößler: Tschüss.
Quellen
- Esch HJ van, Zuylen L van, Geijteman ECT, et al. Effect of Prophylactic Subcutaneous Scopolamine Butylbromide on Death Rattle in Patients at the End of Life. Jama 2021;326:1268–76. doi: 10.1001/jama.2021.14785
- Lokker ME, Zuylen L van, Rijt CCD van der, et al. Prevalence, Impact, and Treatment of Death Rattle: A Systematic Review. J Pain Symptom Manag 2014;47:105–22. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2013.03.011