Faire Finanzierung?
Arbeitgeber zu Sozialversicherungsbeiträgen: Nicht über 40 Prozent!
Die bayerische Wirtschaftsvereinigung warnt, die Sozialgarantie aufzugeben: Das wäre Gift für den Arbeitsmarkt. Die jeweils systembezogenen Argumente von GKV- und PKV-Vertretern belegen die schwierige Lage für die Ampel-Koalition.
Veröffentlicht: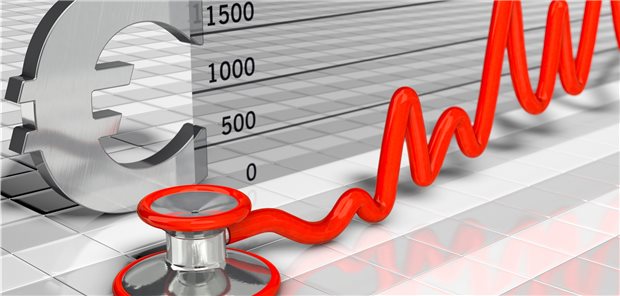
Bisher addieren sich die Sozialversicherungsbeiträge auf knapp 40 Prozent. Arbeitgeber mahnen, diesen Schwellenwert nicht zu überschreiten. Die GKV hingegen plädiert für eine faire Finanzierung ihrer gesamtgesellschaftlichen Aufgaben.
© bluedesign / stock.adobe.com
München. Mit der „Sozialgarantie 2021“ hat sich die damalige Bundesregierung im Sommer 2020 dazu verpflichtet, die Beiträge zur Sozialversicherung bis Ende 2021 bei maximal 40 Prozent zu stabilisieren und darüber hinaus gehenden Finanzbedarf aus Bundesmitteln zu finanzieren. An dieser Regelung perspektivisch festzuhalten, würde stark steigende Steuerzuschüsse nach sich ziehen.
Nach Ansicht von Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Wirtschaftsvereinigung vbw, sollte eine Anhebung der in Deutschland ohnehin vergleichsweise hohen Sozialversicherungsbeiträge dringend vermieden werden. „Das ist für uns ein absolutes No-Go“, sagte er am Mittwoch auf einer Online-Veranstaltung des Verbands.
Ein solcher Schritt belaste Wirtschaft und Arbeitgeber noch stärker als bisher – und bedeute damit auch einen massiven Wettbewerbsnachteil Deutschlands in der aktuell stattfindenden „Neuverteilung der Arbeitswelt“. „Der Standort Deutschland muss wettbewerbsfähig bleiben“, betonte Brossardt.
Über 40 Prozent? „Dann gibt es kein Halten mehr“
„Wir müssen die Balance zwischen Beiträgen, Leistungsansprüchen und Ausgaben neu justieren, auch im Sinne der Generationengerechtigkeit.“ Gehe man bei der Beitragsbelastung über die Marke von 40 Prozent hinaus, gebe es bei dieser Entwicklung kein Halten mehr, befürchtet er.
„Sozialgarantie“ im Wahljahr
Wie Spahn höhere Kassenbeiträge verhindern will
Ohne Reformen müsste der Gesamtbeitragssatz zur Sozialversicherung bis zum Jahr 2025 allerdings auf 43,2 Prozent steigen, erklärte Professor Thiess Büttner von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Seinen Berechnungen zufolge müssten in Summe über die nächsten vier Jahre zusätzlich 144 Milliarden Euro an Steuermitteln in die Sozialversicherungszweige fließen, wenn der Beitragssatz bei 40 Prozent stabilisiert werden soll. Das sei Geld, das für andere, dringend benötigte Investitionen fehle, beispielsweise in Bildung, Forschung, Digitalisierung und Klimaschutz. Der Bund hatte im vergangenen Jahr seinen Zuschuss für die GKV auf 28,5 Milliarden Euro verdoppelt.
Steuerzuschüsse haben stabilisierende Wirkung in der Pandemie
Die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands Dr. Doris Pfeiffer verwies auf die stabilisierende Wirkung, die diese Zuschüsse in der aktuellen, pandemiebedingten Ausnahmelage auf die Krankenkassen haben. Die Lage dürfte sich aber schon bald drastisch verändern. „Ab 2023 werden Bundeszuschüsse in dieser Dimension entfallen“, sagte sie.
Bei der Beurteilung der Finanzlage der GKV und der Berechnung von Defiziten sei wichtig, zwischen Zuschüssen und Vergütungen für Aufgaben zu unterscheiden, die die Kassen im Auftrag des Staates erbringen, beispielsweise der Versicherungsschutz der Bezieher von Arbeitslosengeld II. „Hier fehlen den Krankenkassen zehn Milliarden Euro“, sagte Pfeiffer. Von einer Subventionierung der GKV könne hierbei keine Rede sein.
Gleichzeitig unterstütze die GKV mit Versicherungsbeiträgen den Bundeshaushalt, beispielsweise in Form der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel, die in voller Höhe anfallen. „Wenn man den Satz halbiert, würde das fünf Milliarden Euro bedeuten“, rechnete Pfeiffer vor. „Das sind alles Punkte, die eine wesentliche Stabilisierung bewirken würden.“
PKV will mehr Systemgerechtigkeit
Nach Ansicht von Florian Reuther, Direktor des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV), lassen sich mit Steuerzuschüssen keine Probleme lösen – die Politik kaufe damit lediglich Zeit. Er forderte grundsätzlich „mehr Systemgerechtigkeit in der Finanzierung“. Zuschüsse müssten klar adressiert werden und seien nur unter bestimmten Bedingungen zu rechtfertigen. „Jeder Zuschuss, der nicht wegen gesamtgesellschaftlicher Aufgaben erfolgt, ist ein Eingriff in die Dualität und ein Wettbewerbsnachteil für die private Krankenversicherung.“
Privat Versicherte zahlten Steuern, erhielten aber keine Steuerzuschüsse, kritisierte er. Auch der pauschal ausgestaltete Zuschuss von einer Milliarde Euro, die die Pflegeversicherung im Zuge der Corona-Krise erhalten hat, sei ein „massiver Eingriff“.
Zu einer zukunftssicheren Finanzierung des Gesundheitssystems gehört laut Reuther in jedem Fall mehr Eigenvorsorge der Versicherten. „Wir können den Jüngeren nicht mehr versprechen, dass alles finanziert wird, ohne dass Eigenvorsorge betrieben wird.“









