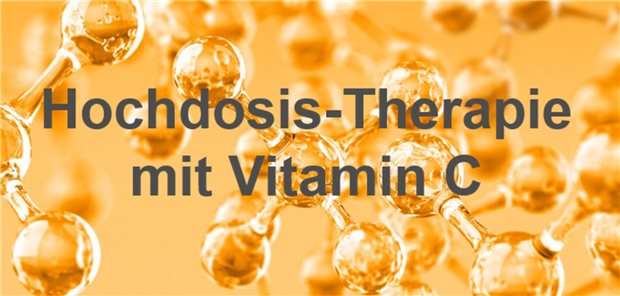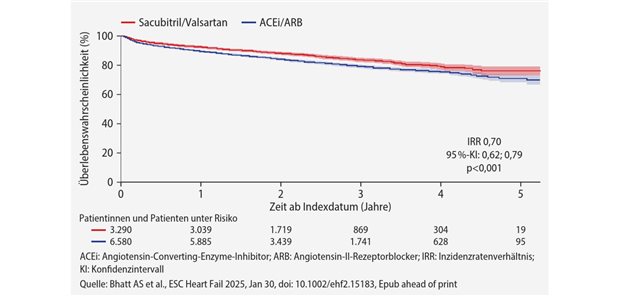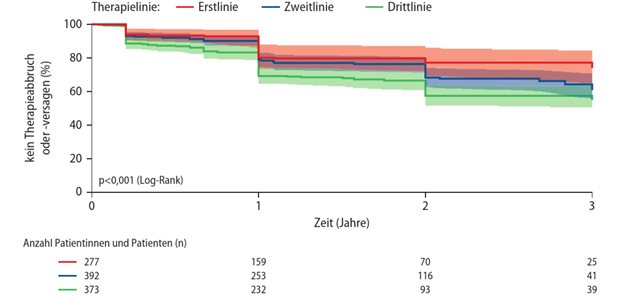Vor dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz
DGIM: Digitalisierung muss sich in bessere Versorgung umsetzen
Internisten fordern, Wege zur Nutzung der elektronischen Patientenakte frei zu machen. Das erfordere eine stärkere Verbreitung der Akten – und einen Mehrwert für die Ärzte. DGIM-Kongress beleuchtet selten erkannte Immunkrankheit.
Veröffentlicht:
Gesundheitsdaten gibt es zuhauf, auch aus der Glukosemessung von Diabetikern per App und DIGA. Die klinische Forschung hat allerdings wenig Zugriffsmöglichkeiten, beklagen Wissenschaftler.
© lukszczepanski / stock.adobe.com
Berlin. Nur gut 500.000 Menschen in Deutschland verfügen bislang über eine elektronische Patientenakte (ePA). Viel zu wenige, finden führende Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM). Im Vorfeld des Internistenkongresses im April erhoben sie die Forderung, beim geplanten Gesundheitsdatennutzungsgesetz die Bedarfe der Wissenschaft zu berücksichtigen. Daten aus dem Bevölkerungsquerschnitt, dem Gesundheitssystem oder aus abgeschlossenen klinischen Studien könnten wichtige Informationen für Prävention und Therapie von Krankheiten liefern.
Um die Verbreitung der ePA zu fördern, plant die Regierung, die Akte künftig mit einer Opt-out-Regelung zu versehen. Bislang gilt eine Opt-in-Regelung.
Datenfluss bislang weitgehend blockiert
Die Umstellung von Papier in die Elektronik sei in Praxen und Kliniken ein Riesenaufwand und ohne ausreichende Vergütung nicht zu leisten, sagte DGIM-Generalsekretär Professor Georg Ertl am Dienstag in Berlin. Wenn Ärzte dazu verpflichtet würden, an dieser Stelle etwas umzusetzen, dann müssten auch deren Interessen berücksichtigt werden, sprich: Was Ärzte dort leisteten, müsse sich in bessere Versorgung umsetzen.
Das heiße, die Daten müssten genutzt werden können. Studien aus der Fusion von routinemäßig erhobenen Daten und spezifisch für Studien erhobenen Daten seien in Deutschland allerdings bislang nicht möglich. Trotz des geringen Nutzungsgrades der ePA gebe es auch in Deutschland breite Zustimmung zur Nutzung von Gesundheitsdaten. Das zeigten unter anderem Rückmeldungen aus internistischen Selbsthilfegruppen, so Ertl.
Exakt 40 Digitale Gesundheitsanwendungen können hierzulande verordnet werden, sagte Professor Martin Möckel, Sprecher der DGIM-Arbeitsgruppe der DIGA/KI in Leitlinien. Deutschland ist an dieser Stelle Vorreiter. Nach wie vor sei es eine Herausforderung für Ärzte, mit den DIGA umzugehen. Um sie zielführend verordnen zu können, benötigten die Ärzte detaillierte Kenntnisse der Anwendung, die sie aus Testzugängen ziehen könnten. Hier gebe es inzwischen Verbesserungen, sagte Möckel.
Angriff des Immunsystems auf den Körper
Bei der DIGA bislang nicht mitgedacht seien analog zur medikamentösen Therapie regelmäßige Konsultationen zur Überprüfung der Wirksamkeit. Dafür gebe es noch keine „Vergütungsmatrix“.
Ein Schwerpunktthema des Kongresses vom 22. bis 25. April unter dem Motto „Systemisch Denken – Individuell Therapieren“ sollen neue Erkenntnisse über das körpereigene Immunsystem als Entzündungsauslöser sein. Etwa einem auf 100.000 Menschen widerfahre es, dass sich das Immunsystem in Form des Immunglobulins G4 (IgG4) gegen den eigenen Organismus wende.
Erst seit zehn Jahren beginne man, diese Vorgänge zu verstehen. Betroffen sein könnten von den Augen bis zum zentralen Nervensystem sehr viele Organe, weswegen dieses Thema alle Fachgebiete adressiere, sagte Professor Ulf Müller-Ladner, aktueller Vorsitzender der DGIM. Die „Ig4G-assoziierten, chronisch-entzündlich fibrosierenden Erkrankungen“ würden oft erst spät im Verlauf diagnostiziert. Das führe dazu, dass mehr als die Hälfte der Patienten zum Diagnosezeitpunkt bereits irreversible Organschädigungen aufweise. Dafür wolle die DGIM die Ärzte sensibilisieren. (af)