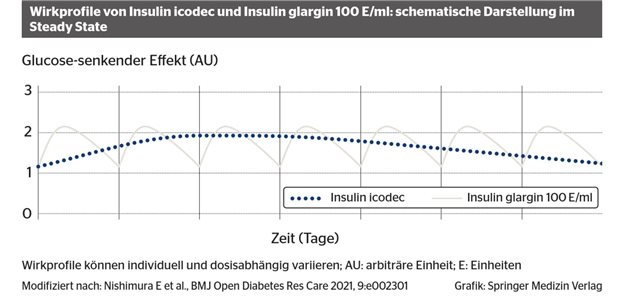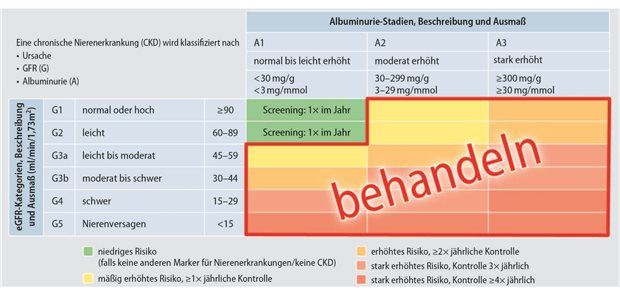Chronisch kranke Kinder
Diabetologen: Gesundheitspersonal an Schulen erhöht Bildungschancen
Lehrervertreter und Ärzte setzen sich für den flächendeckenden Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften ein. Der Schritt sei sinnvoll, mach- und finanzierbar, betont die Deutsche Diabetes Gesellschaft.
Veröffentlicht:
Lehrangebot für alle ermöglichen: Jährlich erkranken in Deutschland rund 3500 Kinder und Jugendliche neu an Diabetes Typ 1.
© Bernd Wüstneck / dpa / picture alliance
Berlin. Lehrervertreter haben eine bessere Betreuung chronisch kranker Kinder in Schulen gefordert. Um Einzelfälle handele es sich dabei nicht, sagte der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, bei einer Online-Pressekonferenz der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und der Selbsthilfeorganisation diabetesDE am Dienstag.
„Aktuell benötigt fast ein Viertel der Kinder eine weitergehende medizinische oder therapeutische Unterstützung“, so Beckmann. Daher könnten außer Schülern auch Lehrkräfte von Schulgesundheitsfachkräften profitieren, wie sie DDG und diabetesDE seit Jahren forderten.
Lehrer mit der Aufgabe oft überfordert
Die Verantwortung, Kindern mit chronischer Erkrankung wie etwa Diabetes Typ 1 den Schulbesuch zu ermöglichen, könne nicht bei den Lehrkräften liegen, stellte Beckmann klar. Diese übernähmen die Aufgabe zwar notgedrungen, seien dafür aber nicht qualifiziert. Überdies bewegten sie sich in einer rechtlichen Grauzone.
Diabetes und Herz
Diabetologen empfehlen Herzinsuffizienz-Screening
Bund und Länder stünden deshalb in der Pflicht, ein „professionelles Schulgesundheitsmanagement mit dafür ausgebildeten Schulgesundheitsfachkräften zu etablieren und zu finanzieren“. Das trage nicht nur der stetig steigenden Anzahl an chronisch erkrankten Kindern Rechnung, sondern fördere das Gesundheitsbewusstsein von Kindern allgemein, so der VBE-Vorsitzende.
Eins von 500 Kindern mit Diagnose Diabetes
Durchschnittlich eines von 500 Kindern in Deutschland erhalte derzeit die Diagnose Diabetes Typ 1, rechnete DDG-Präsident Professor Andreas Neu vor. Für die Kinder und ihre Eltern ändere sich das Leben nach der Diagnose grundlegend. „Wenn Kinder an einem Diabetes erkranken, müssen sie ihr Essen, die körperliche Bewegung und die Insulindosierung aufeinander abstimmen. Zumindest im Grundschulalter sind Kinder damit häufig überfordert“, so Neu.
Diskussion über Zuckersteuer
Diabetes-Gefahr: Warum Ärzten Süßes sauer aufstößt
Allein die Interpretation täglicher Blutzuckerwerte stelle die Kleinen vor große Herausforderungen. Zeige das Messgerät einen Wert von 167, fragten sie sich etwa: „Kann ich problemlos zu Mittag essen? Welche Insulindosierung passt zu diesem Blutzuckerwert?“ Fragen wie diese können meist auch Lehrer nicht beantworten.
Mehr Inklusion und bessere Integration
Der DDG-Chef kritisierte, dass es in Deutschland noch immer keine flächendeckenden Maßnahmen zur Inklusion und Integration von Kindern mit der Diagnose Diabetes Typ 1 in Bildungseinrichtungen gebe. „Das führt dazu, dass die jungen Patientinnen und Patienten immer wieder vom Regelschulbesuch ausgeschlossen werden.“
Neu und Beckmann verwiesen auf eine Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen. Diese hatte die in einem Modellprojekt zum Einsatz kommenden Schulgesundheitsfachkräfte auf ihre Wirkung hin evaluiert. Das Ergebnis zeige, dass der Einsatz von Gesundheitsfachkräften an Schulen „sinnvoll, mach- und finanzierbar“ sei. Die Fachkräfte entlasteten das Schulsystem und seien auch volkswirtschaftlich eine lohnende Investition. (hom)