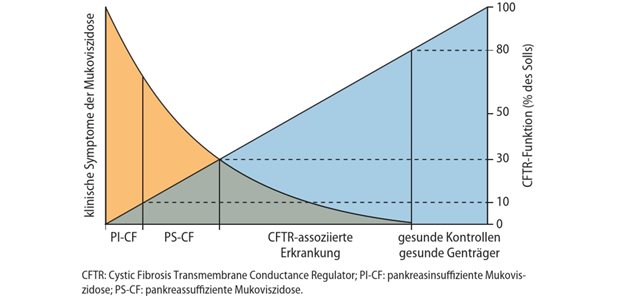100 Jahre Insulintherapie
Diabetologen machen Lücken in der Versorgung von Kindern aus
Am 23. Januar 1922 wird ein an Diabetes erkrankter Junge mit einem neuen Extrakt behandelt: Insulin. Es ist ein Wendepunkt in der Diabetesversorgung. Doch noch immer müssen betroffene Kinder im Alltag etliche Hürden nehmen.
Veröffentlicht:
Diabetologen fordern: Fachkompetente Betreuung von Kindesbeinen an.
© Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa
Berlin. Rückblick, Januar 1922: Leonard Thompson ist zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Er leidet an Diabetes. Wenige Wochen vorher ist er ins Toronto General Hospital eingeliefert worden. Die Ärzte dort beschreiben ihn als abgemagert, kraftlos, dem Tode geweiht. Die durchschnittliche Überlebenszeit nach der Diagnose Diabetes liegt damals bei neun Monaten.
Am 23. Januar erhält Leonard Thompson erst fünf, dann 20 und einen Tag später zweimal zehn Milliliter eines neuen Extrakts, das später in die Medizingeschichte eingehen wird: Insulin.
Leonards Gesundheitszustand verbessert sich durch die Insulingabe schlagartig. Die Blutzuckerwerte normalisieren sich, schwere Stoffwechselentgleisungen kommen ins Gleichgewicht und er fühlt sich wieder aktiver.
Zäsur in der Diabetesversorgung
Noch im Februar 1922 werden weitere sechs Patienten des Krankenhauses mit Insulin behandelt – alle mit guten Ergebnissen. Der neue Extrakt und die ersten Erfolge damit werden im Mai desselben Jahres erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Professor Andreas Neu, Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG), spricht vom Jahr 1922 als einem Wendepunkt in der Diabetesversorgung: „Wenn wir bedenken, dass bis dahin die Diagnose eines Typ-1-Diabetes gleichbedeutend mit dem sicheren Tod war, kann man ermessen, welche Zäsur die Entdeckung und Etablierung der Insulintherapie darstellt“, sagt der Tübinger Facharzt für Kinderheilkunde.
Rasch folgt die industrielle Insulinproduktion sowohl in den USA als auch in Europa. 1924 kommt die erste Insulinspritze auf den Markt, 1934 das erste Verzögerungsinsulin. 1983 werden tierische Insuline durch Humaninsuline ersetzt – die erste Insulinpumpe entdeckt das Licht der Welt.
Erleichterungen und technische Neuerungen
Heute, fast auf den Tag genau 100 Jahre später, nutzten mehr als 60 Prozent aller an Diabetes erkrankten Kinder und Jugendlichen eine solche Pumpe, im Kleinkindesalter seien es sogar über 90 Prozent, sagt Neu. Immer mehr Teenager verwendeten zudem einen Sensor zur Glukosebestimmung.
Dennoch, schränkt der DDG-Präsident ein, bedeute die Diagnose Diabetes mellitus auch heute noch: „Mehrfach täglich Glukosemessungen blutig oder mit Sensor, Insulingaben zu jeder Mahlzeit, Abschätzen der Kohlenhydratmengen beim Essen, Unterzuckerprophylaxe beim Sport, Kontrollen in der Nacht und die Notwendigkeit, alle Hilfsmittel und Insulin jederzeit parat zu haben.“
Dass diese Dinge – trotz aller Erleichterungen und technischer Neuerungen – für Kinder, Jugendliche und deren Familie nach wie vor eine Hürde im Alltag bedeuten würden, sei „unstrittig“, betont Neu. Erschwerend kämen regionale Unterschiede in der Versorgung und eine unzureichende Inklusion in Kitas und Schulen hinzu. Mütter diabeteskranker Kinder müssten dann nicht selten ihre Berufstätigkeit einschränken – verbunden mit erheblichen Gehaltseinbußen.
Lücken in der Betreuung schließen
Schwierigkeiten hätten insbesondere Familien, die über wenig Gesundheitskompetenz verfügten, oder aber Familien mit Integrationshintergrund. „Aus diesem Grund brauchen wir eine fachkompetente und zugewandte Betreuung der Patienten mit Typ-1-Diabetes – insbesondere bei Erkrankungsbeginn im Kindes- und Jugendalter“, fordert Neu.
Multiprofessionelle und spezialisierte Teams sollten flächendeckend an jeder Kinderklinik etabliert sein und sowohl die Erstversorgung sichern als auch eine verlässliche Langzeitbegleitung gewährleisten. Dazu gehöre auch die psychosoziale Begleitung der Familien. „Nur so kann es gelingen, den Alltag von Heranwachsenden mit Diabetes so zu gestalten, dass er altersgerecht ist und ein Leben erlaubt, wie es Gleichaltrige ohne Diabetes führen“, ist Neu überzeugt.
Eine Situation, wie sie sich für an Diabetes erkrankte Kinder und deren Familien Anfang 1922 dargestellt hat, ist heute aber undenkbar – auch dank der Errungenschaft Insulin.