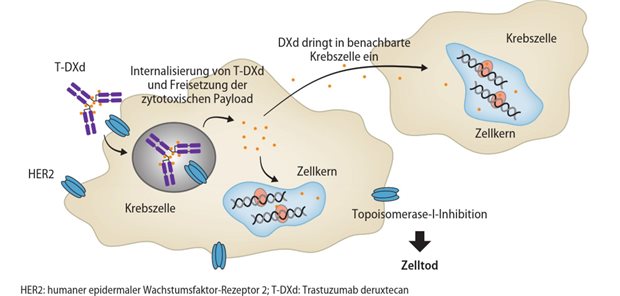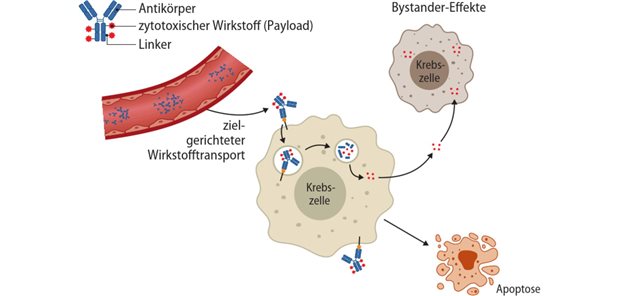Geplante Reform
GBA will auch bauliche Standards bei der Intensivpflege festlegen
Am Mittwoch befasst sich der Gesundheitsausschuss des Bundestags mit Spahns geplanter Intensivpflegereform. Nicht nur die gemeinsame Selbstverwaltung spricht sich für weitere Nachbesserungen aus.
Veröffentlicht:
Diese 19-jährige Patientin mit spinaler Muskelatrophie wird zu Hause beatmet – die Sorgen vieler Betroffener vor dem geplanten Intensivpflegegesetz waren zuletzt groß.
© Uwe Zucchi/dpa
Berlin. Mit Blick auf die geplante Intensivpflege-Reform drängt der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) auf weitere Nachbesserungen.
Bei der am Mittwoch im Bundestags-Gesundheitsausschuss stattfindenden Expertenanhörung zum Gesetz wolle man dafür kämpfen, dass der GBA nicht nur personelle und fachliche Anforderungen „für die häusliche Pflege und diese teilweise ominösen Wohngemeinschaften definieren darf, sondern dass wir auch die Befugnis bekommen, bundeseinheitliche bauliche Mindestanforderungen zu definieren“, sagte der unparteiische Vorsitzende des Gremiums, Professor Josef Hecken.
Bauliche Anforderungen festlegen
Die Regelung baulicher Anforderungen sei bislang Ländersache, sagte Hecken. „Und da gibt es Unterschiede.“ In manchen Bundesländern könnten Anbieter eine Wohngemeinschaft für „acht beatmungspflichtige Patienten im achten Stock mit einem Klo“ vorhalten. Andere Länder hätten für strengere Auflagen gesorgt. Zudem reklamiert der GBA für sich, Anforderungen zum Entlassmanagement im Krankenhaus regeln zu dürfen.
Laut Gesetzentwurf soll der GBA Richtlinien zur außerklinischen Intensivpflege erarbeiten. Darin sollen Qualitätsanforderungen für die Leistungserbringer festgezurrt sein.
Zu kurze Frist für Richtlinie
In ihrer Stellungnahme kritisieren die unparteiischen GBA-Mitglieder zudem die vom Gesetzgeber vorgesehene Frist für die Erarbeitung der Richtlinien. Die Frist sei von zwölf auf 18 Monate zu verlängern. Die Neuregelung sei „umfangreich“ und „komplex“, heißt es zur Begründung.
Gesundheitsminister Jens Spahn begibt sich mit seiner geplanten Intensivpflege-Reform auf heikles Terrain. Den ursprünglichen Gesetzesentwurf hat der CDU-Politiker nach massiven Protesten bereits mehrfach nachgebessert.
Dies wird in den zahlreichen Stellungnahmen, die zur Anhörung am Mittwoch vorliegen, zwar ausdrücklich als „Fortschritt“ gewertet. Gleichwohl werden weiter Korrekturen am Gesetzentwurf angemahnt.
Sektorenübergreifendes Modell
Die Deutsche Interdisziplinäre Gesellschaft für Außerklinische Beatmung (DIGAB) etwa macht sich für ein „echtes sektorenübergreifendes Modell“ in der außerklinischen Intensivversorgung stark. Vorbild dafür könne die spezielle ambulante Palliativversorgung (SAPV) sein – bestehend aus Teams aus ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Experten.
Ähnlich positioniert sich die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP). Nötig sei eine „weitergehende, sektorenübergreifende Betreuung“ von Intensivpflegepatienten nicht nur durch niedergelassene Ärzte, sondern auch durch im stationären Weaningbereich tätige Weaning-Experten. „Dies sollte auch ein dauerhaftes Betreuungskonzept darstellen“, so die DGP.
Hausarzt als Koordinator
Da viele Patienten mit Intensivpflegebedarf ein „komplexes, multimorbides Krankheitsgeschehen“ aufwiesen, müssten „Hausärzte mit entsprechender Erfahrung wichtige Partner in der Versorgung“ sein und die Behandlung koordinieren, fordert wiederum die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Beurteilung des Weaningpotenzials obliege aufgrund der Weiterbildungsordnung „selbstverständlich“ dem Facharzt für Lungenheilkunde.
Kritik am Reformplan entzündet sich aber auch weiter daran, dass die Medizinischen Dienste (MD) im Auftrag der Kassen bei „persönlichen Begutachtungen am Leistungsort“ alle zwölf Monate überprüfen sollen, ob die medizinische-pflegerische Versorgung „tatsächlich“ und „dauerhaft“ sichergestellt ist. Der „Leistungsort“ kann eine Pflege- oder Behinderteneinrichtung, eine Intensivpflege-WG oder das eigene Zuhause sein.
Schwammige Begrifflichkeiten
„Grundsätzlich“ sei die damit beabsichtige stärkere Kontrolle zu Hause und in Wohneinheiten „richtig“, stellt die Deutsche Stiftung Patientenschutz fest. Allerdings fehle eine genaue Beschreibung der Kriterien „tatsächlich“ und „dauerhaft“ sowie eine Definition, was der MD prüfe. Die Kassen hätten einen zu großen „Entscheidungs- und Interpretationsspielraum“, was bei Patienten und Angehörigen Ängste schüre.
Mängel in der häuslichen Versorgung dürften nicht „sofort zwangsläufig“ in eine stationäre Versorgung führen, fordern die Patientenschützer weiter.