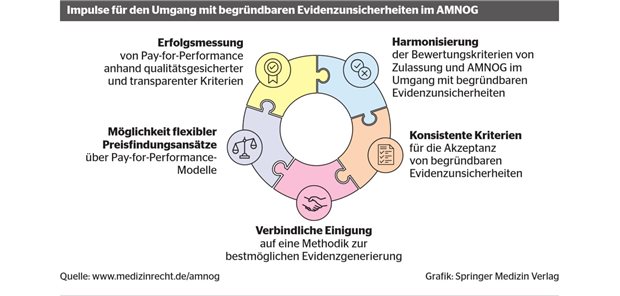Schleswig-Holstein
Medikamententests aus finanzieller Notlage
Zwischenbericht vor dem Sozialausschuss verdeutlicht, dass Tests bis zur Mitte der siebziger Jahre in Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie in der Erwachsenen-, Kinder- und Jugendpsychiatrie üblich waren.
Veröffentlicht:Kiel. Ausmaß und Hintergründe der Medikamentenversuche in den früheren Landeskrankenhäusern in Schleswig-Holstein werden derzeit noch untersucht. Ein Zwischenbericht macht deutlich, dass auch finanzieller Druck zu den Versuchen zwischen den 50er und 70er Jahren beigetragen hat.
Fest steht auch, dass nicht nur mehrere psychiatrische Einrichtungen, sondern auch andere Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte in Schleswig-Holstein an den Prüfungen und Anwendungsstudien pharmazeutischer Produkte beteiligt waren.
Mit der wissenschaftlichen Untersuchung der vor einigen Jahren durch Betroffene publik gemachten Versuche hatte das schleswig-holsteinische Sozialministerium das Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung der Universität Lübeck beauftragt.
Dr. Christof Beyer aus dem Institut machte bei seinem Zwischenbericht vor dem Sozialausschuss deutlich, dass die Tests bis zur Mitte der siebziger Jahre in Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie in der Erwachsenen-, Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht unüblich waren.
Steigende Kosten für Psychopharmaka
Wie sehr die Betroffenen darunter gelitten haben, hatten diese Ende 2017 in einem Symposium im schleswig-holsteinischen Landtag bereits berichtet. Neu ist im Zwischenbericht die Erkenntnis, dass finanzieller Druck die Verantwortlichen in ihren Entscheidungen beeinflusst hat.
Knappe Haushaltsmittel und steigende Kosten für Psychopharmaka in den 50er Jahren haben laut Uni Lübeck dazu geführt, dass die Landeskrankenhäuser in Schleswig und in Heiligenhafen das damals zuständige Innenministerium über den Einsatz kostenloser Ärztemuster und neuer Präparate unter dem Aspekt der Kostensenkung informierten.
Hinweise auf Medikamententestungen fand die Uni Lübeck in mehr als 30 Artikeln aus Fachzeitschriften für den Zeitraum 1953 bis 1973. Neben Schleswig und Heiligenhafen gab es solche Versuche auch in der psychiatrischen Klinik der Uni Kiel, der psychiatrischen und neurologischen Klinik der Medizinischen Akademie Lübeck sowie im psychiatrisch-neurologischen Krankenhaus des Diakoniewerkes in Kropp.
„Aufklärung und Einwilligung von Probanden finden in keinem der Fachartikel Erwähnung“, teilte das Institut mit. Gelegentlich werden in den Veröffentlichungen dagegen Nebenwirkungen beschrieben, unter denen die Patienten litten. Neben den Medikamentenversuchen finden sich in den Unterlagen auch Hinweise auf Gewalt gegen Patienten. Diese Missstände werden gesondert untersucht.
Aufklärung fortsetzen
Nach dem Zwischenbericht sehen sich Sozialpolitiker aller Parteien darin bestätigt, die Aufklärung über die Medikamentenversuche fortzusetzen. „Der Zwischenbericht macht erschreckend deutlich, dass Willkür und und Missachtung von Menschenrechten in den Einrichtungen geschehen sind“, sagte SPD-Politikerin Birte Pauls.
Für ihre CDU-Kollegin Katja Rathje-Hoffmann steht fest: „Erwachsene und Kinder wurden als Versuchskaninchen durch Pharmafirmen missbraucht“. Sie sieht „üble Praktiken aus dem Dritten Reich aus der Erforschung von Arzneien“ bis etwa 1960 noch an der Tagesordnung.
Ärztin und Grünen-Politikerin Dr. Marret Bohn sprach von „schockierenden Einzelheiten“. Sie forderte Pharmakonzerne auf, ihre „Blockadehaltung“ bei der Aufklärung aufzugeben. Laut Uni Lübeck deuten die in Pharma-Archiven gesichteten Dokumente auf weitere Forschungskooperationen hin.
Das Institut spricht von Anhaltspunkten für den Einsatz von Antiepileptika, Psychopharmaka, Antidepressiva und Beruhigungsmitteln. Für Prüfung und Publikation der Ergebnisse finden sich Hinweise auf Honorierungen.
670 positiv beschiedene Anträge
Das Kieler Sozialministerium erinnerte daran, dass Betroffene noch bis zum Jahresende finanzielle Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen sowie Rentenersatzleistungen beantragen können. Bislang wurden 670 von 1150 gestellten Anträgen positiv beschieden und rund sieben Millionen Euro ausgezahlt.
Sozialminister Dr. Heiner Garg stellte aber zugleich klar: „Keine materielle Leistung kann geschehenes Leid und Unrecht rückgängig machen.“ Seit Jahresbeginn hat das Ministerium einen unabhängigen Beauftragten berufen, um die Anliegen der Betroffenen zu unterstützen.