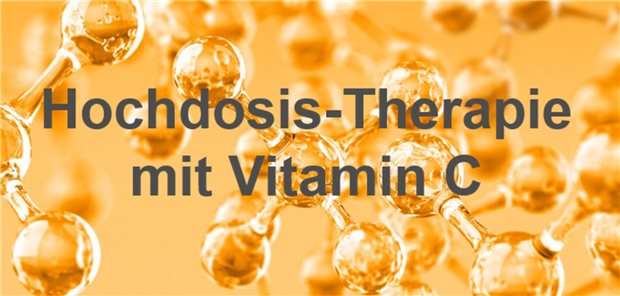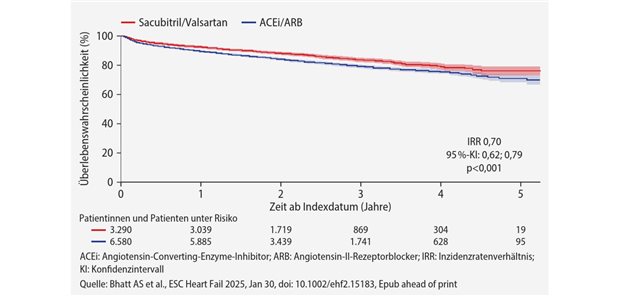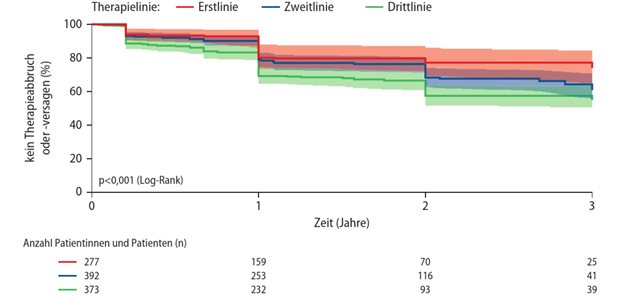DSO-Jahrestagung
Organspende: Noch zu häufig entscheiden Angehörige
Die Zahl der Organspender steigt. Doch damit geben sich Transplantationsmediziner nicht zufrieden: Der Patientenwille werde zu selten von den Betroffenen selbst, also noch zu Lebzeiten, dokumentiert.
Veröffentlicht:
Organspendeausweis ausgefüllt? Nur 15 Prozent der möglichen Spender, die im vergangenen Jahr der DSO gemeldet wurden, hatten ihre Spendebereitschaft schriftlich dokumentiert.
© Petra Steuer / JOKER / picture a
Frankfurt/Main. Kein Abwärtstrend trotz SARS-CoV-2: Bereits im Sommer hatte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) vermeldet, dass die Zahl der Organspender trotz der Corona-Pandemie gestiegen ist. Bis Ende Juni registrierte die Stiftung 487 postmortale Spender, Stand Ende Oktober sind es 793.
Das ist eine leichte Steigerung von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, hieß es am Dienstag auf dem DSO-Jahreskongress, der wegen der Pandemie dieses Jahr rein digital stattfindet.
Der Blick in die europäischen Nachbarländer zeigt aber, dass dieses kleine Plus mehr wiegt als in den Jahren zuvor. In Spanien etwa seien im Frühjahr die Organspenderzahlen auf fast ein Viertel der früheren Aktivität zurückgegangen. Spanien gilt als besonders schwer betroffen von der Pandemie.
Mehr Kontakte zwischen Kliniken und DSO
Die DSO schreibt das Plus vor allem dem Engagement in den Kliniken zu, trotz des Fokus auf Corona an die Organspende zu denken. So hätten die organspendebezogenen Kontakte zur DSO als Koordinierungsstelle ebenfalls zugenommen, um 4,1 Prozent auf 2626 Kontakte.
Dennoch müsse mehr und vor allem früher über das Thema Organspende gesprochen werden, mahnten Transplantationsmediziner auf der Tagung. „Wir müssen wissen, was der Patient möchte“, sagte Professor Klaus Hahnenkamp, Sprecher der Sektion Organspende und Organtransplantation bei der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).
Die gelebte Praxis in der Intensivmedizin in den letzten Jahren habe dabei sicherlich nicht förderlich gewirkt, sondern das bewusste Auseinandersetzen mit dem Organspendewillen auch in der Patientenverfügung eher in den Hintergrund gerückt, gestand er ein. Oft hätten die Patienten auch Angst, dass zu viel an medizinischen Maßnahmen auf den Intensivstationen getan werde.
Transparenz für Angehörige schaffen
Helfen soll die überarbeitete Richtlinie „Spendererkennung“ der Bundesärztekammer (BÄK), die seit September – wenn auch bislang etwas zu geräuschlos, wie Tagungsteilnehmer kritisierten – in Kraft ist. Danach soll bereits vor einer Entscheidung zur Therapiebegrenzung der Wille zur Organspende erkundet werden.
„Ich glaube wir können uns allen und den Patientenvertretern auch mehr zutrauen“, ermunterte er die Kollegen aus den Kliniken. Das Gespräch mit den Angehörigen sollte bereits stattfinden, wenn der Eintritt des Hirntods wahrscheinlich sei, so Hahnenkamp, der Mitautor der Richtlinie ist.
Wichtig sei dabei Transparenz, nicht nur über die medizinischen Maßnahmen, die ergriffen würden. Die Angehörigen sollten auch auf den zeitlichen Rahmen der Organspende bzw. dafür notwendigen intensivmedizinischen Maßnahmen vorbereitet werden.
Zu wenige besitzen einen Organspendeausweis
Dennoch appelliert auch Hahnenkamp, möglichst zu Lebzeiten selbst eine persönliche Entscheidung zur Organspende zu treffen und diese auch zu dokumentieren. Das hatten von den bei der DSO gemeldeten möglichen Organspendern im vergangenen Jahr allerdings gerade einmal 15 Prozent getan.
Hinzu kommen außerdem neue Zahlen, wonach tatsächlich mehr Gestorbene für eine Organspende infrage kommen könnten als bislang realisiert werden. Seit vergangenem Jahr müssen alle der rund 1200 Entnahmekrankenhäuser Daten für die „Todesfallanalyse“ bereitstellen.
Darin werden alle Todesfälle mit primärer oder sekundärer Hirnschädigung erfasst – demt maßgeblichen Kriterium pro postmortaler Organentnahme – sowie die Gründe, die eine Organspende verhindert haben. Nach einer ersten Auswertung der DSO hätten 2019 bundesweit doppelt so viele Menschen nach ihrem Tod Organspender werden können. (reh)