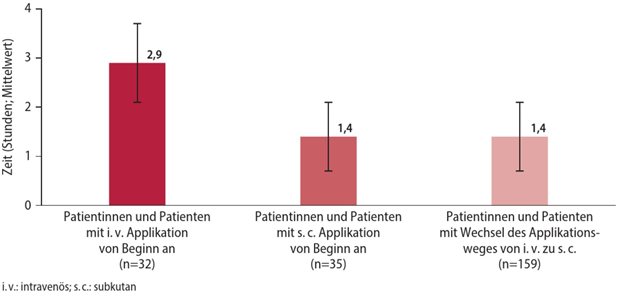Lob für Deutschland
Praxen haben großen Anteil am glimpflichen Corona-Pandemieverlauf
Dank guter ambulanter Versorgung blieb das Infektionsgeschehen in deutschen Kliniken vergleichbar gering. Vor allem in der ersten Pandemiewelle haben Infektionsketten in Krankenhäusern vieler europäischer Länder die Lage erheblich verschlimmert. Das geht aus einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts der PKV hervor.
Veröffentlicht:
Im Vergleich mit vielen anderen europäischen Ländern ist die Bekämpfung von COVID-19 in Deutschland recht erfolgreich gewesen. Das geht aus einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts der PKV hervor.
© AIDAsign / stock.adobe.com
Köln. Die leistungsstarke ambulante Versorgung sowie die hohe Intensivbettenkapazität sind zwei wesentliche Gründe dafür, dass Deutschland bisher so gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist.
Zu diesem Ergebnis kommt das Wissenschaftliche Institut der Privaten Krankenversicherung (WIP) in einer aktuellen Studie, in der Gesundheitssysteme von 15 europäischen Ländern in der Pandemie verglichen werden.
Deutschland weist im bisherigen Pandemieverlauf mit 2,4 Prozent eine relativ stabile Fallsterblichkeit auf niedrigem Niveau auf, berichtete WIP-Leiter Dr. Frank Wild bei der Vorstellung der Studienergebnisse.
Das bedeutet, dass der Anteil der Corona-Infektionen, die zum Tod geführt haben, vergleichsweise gering ist. Im vergangenen Jahr lag der Wert in anderen europäischen Ländern oft monatelang über zehn Prozent, teilweise sogar über 15 Prozent.
Krankenhäuser: Hotspot des Infektionsgeschehens
Dass die Pandemie hierzulande bisher vergleichsweise glimpflich verlaufen ist, ist laut Wild „Ausdruck des Gesundheitswesens“, also eine Frage der Qualität und Ausgestaltung der medizinischen Versorgungs- und Behandlungsmöglichkeiten in einem Land.
Vor allem dem ambulanten Sektor, also der hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung, komme hier eine entscheidende Rolle zu. „Wenn es gelingt, die COVID-19-Patienten in der ambulanten Versorgung zu behalten, dann vermeidet man Infektionen in Krankenhäusern“, erläuterte Wild. Vor allem in der ersten Phase der Pandemie hätten sich Infektionsketten in den Krankenhäusern in anderen Ländern als großes Problem erwiesen – was teilweise immer noch zu beobachten sei.
Deutschland habe auch von seiner hohen Kapazität an Intensivbetten profitiert. Hierzulande stehen mehr als 30 Intensivbetten je 100.000 Einwohner zur Verfügung – das ist der höchste Wert unter den untersuchten Ländern. Zu keinem Zeitpunkt hat die Zahl der Intensivpatienten die sogenannte Reservekapazität an Intensivbetten überschritten, die vom WIP mit 30 Prozent aller verfügbaren Intensivbetten angegeben wurde.
Wild betonte allerdings, dass es sich um eine Betrachtung von Durchschnittswerten handelt. „Das kann regional ganz anders aussehen, da gab es schon Engpässe“, räumte er ein. Die Frage, ob eine Unter- oder Überversorgung vorliegt, könne daher nur individuell beantwortet werden.
Vergleichsweise geringe Übersterblichkeit
Auch mit Blick auf die Übersterblichkeit steht Deutschland im bisherigen Pandemieverlauf gut da. Seit Beginn der Pandemie lag diese bei fünf Prozent. „Das ist ein sehr guter Wert“, sagte Wild. In Spanien und Italien lag die Übersterblichkeit bei 14 Prozent, in Finnland bei zwei und in Dänemark bei ein Prozent. Problematisch sei die Wahl des Vergleichszeitraums, schließlich gebe es auch in normalen Jahren Schwankungen, beispielsweise je nach Schwere einer Influenza-Welle.
Auch wenn der Blick auf einzelne Einrichtungen ein anderes Bild suggeriert hat – es sei in Deutschland unterm Strich gelungen, den Anteil der Todesfälle in der stationären Pflege relativ niedrig zu halten. Das liege vor allem an den umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionen sowie an der Impfpriorisierung, so Wild.
Konzentration auf Sieben-Tage-Inzidenz verzögert Reaktionen
Das WIP zieht eine Reihe von Erkenntnissen aus den bisherigen Monaten der Pandemie: Entscheidend sei gewesen, frühzeitig eindämmende Maßnahmen einzuleiten. „Der Blick auf andere Länder zeigt, es hat nicht viel gebracht, abzuwarten“, sagte Wild. Nötig sei allerdings eine verbesserte Datengrundlage, um das Infektionsgeschehen effektiver zu erfassen und besser darauf zu reagieren.
Die vergangenheitsorientierte Sieben-Tages-Inzidenz führe zu verzögerten Reaktionen. „Wenn wir ein dynamisches Infektionsgeschehen haben, ist das Ganze dann sehr zeitversetzt.“
Zudem moniert das WIP das „mangelhafte kontinuierliche Datenmonitoring“, das zu den bekannten Montags-, Feiertags- und Wochenendeffekten geführt hat, weil viele Daten insbesondere von den Gesundheitsämtern erst mit Verzögerung bereitstanden. Besonders gravierend sei der „Blindflug“ in der Zeit über Weihnachten und Silvester gewesen. „Da ist man zwei, drei Wochen durch einen Tunnel gegangen“, sagte Wild.
Eindämmung macht nur international Sinn
Er warnte davor, die weitere Eindämmung zu sehr als nationale Angelegenheit zu betrachten. „Eine echte Bekämpfung kann nur als globale Aufgabe verstanden werden“, sagte er. Herdenimmunität in einem Land zu erreichen, bringe nichts, wenn die Pandemie in anderen Ländern noch nicht unter Kontrolle sei.
Sorge bereitet Wild, dass es in Deutschland weiterhin viele gefährdete Personen gibt. „Wir haben ein großes negatives Potenzial für viele COVID-Todesfälle“, mahnt er. Der Anteil der Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder Übergewicht sei höher als in vielen anderen Ländern, zudem ist die hiesige Bevölkerung die zweitälteste in Europa.
Außerdem sollte man im Blick behalten, wie sich das Infektionsgeschehen bei Kindern und Jugendlichen entwickelt, für die es noch keine Impfungen beziehungsweise Impfempfehlungen gibt.