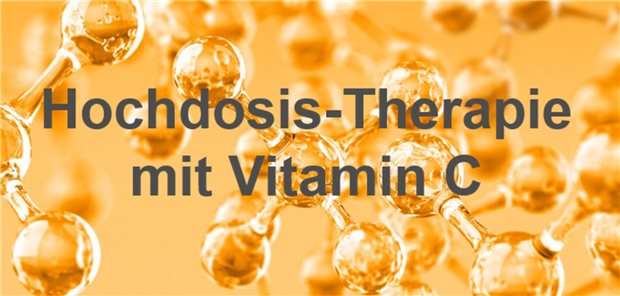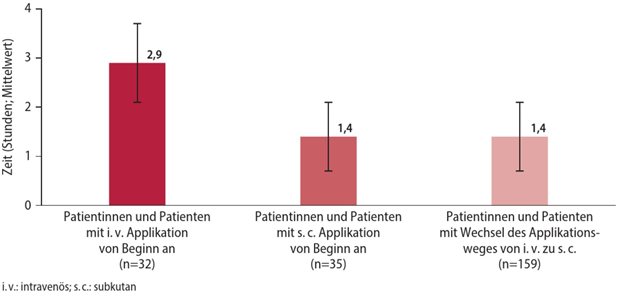Sterben in Pandemie-Zeiten
Steinmeier: Mehr als 70.000 Corona-Tote sind eine erschütternde Dimension
Niemand hält die Hand. Niemand spricht ein letztes Wort. Mehr als 70.000 Menschen sind in Deutschland bereits im Zusammenhang mit COVID-19 gestorben. Viele einsam. In einem Gespräch mit Hinterbliebenen erfährt der Bundespräsident viel über Trauer und Verzweiflung.
Veröffentlicht:
Bundespräsident Steinmeier führt im Schloss Bellevue ein Gespräch mit Hinterbliebenen, die in der Corona-Pandemie Angehörige verloren haben. Anwesend sind auch Kirsten Grieshaber und Aslan Mahmood.
© Wolfgang Kumm/dpa
Berlin. Zum Abschied spielt sie vom Handy „Der letzte Tanz“ von Bosse. „Und dann habe ich zugeguckt, wie mein Kind gestorben ist.“ Michaela Mengel ringt mit den Tränen, als sie am Freitag Frank-Walter Steinmeier von den letzten Momenten mit ihrer Tochter Annalena berichtet. Annalena, die an Heiligabend an COVID-19 erkrankt auf die Intensivstation eines Krankenhauses kommt. Elf Tage lange kämpfen die Ärzte um ihr Leben, das sie dann doch nicht retten können. Da fragen sie die Frau aus Essen, ob sie auf dem Handy vielleicht Musik dabei habe. Michaela Mengel spielt für Annalena das Stück, in dem es um die Vergänglichkeit des Lebens geht. „Und dann war sie einfach weg“, sagt sie über ihre Tochter.
Der Bundespräsident hat in einem Jahr Corona viele Gespräche mit Menschen geführt, die auf unterschiedlichste Weise von der Pandemie betroffen waren und sind. Wohl kaum eines dürfte so eindringlich und emotional gewesen sein wie das vom Freitag. Steinmeier spricht mit Menschen, die in der Pandemie Angehörige verloren haben – die Tochter, den Ehemann, den Vater.
71 .504 Tote – das sei „eine erschütternde, verstörende Dimension“, sagt der Bundespräsident. Und das sei nicht einfach Statistik. „Hinter jeder einzelnen Zahl steht ein Schicksal, steht ein Mensch, der von uns gegangen ist“, so Steinmeier. „Dahinter stehen Menschen, die ihre Liebsten verloren haben, Menschen, die gebangt, gezittert, gekämpft haben, die sich manchmal nicht einmal verabschieden konnten. Dahinter stehen unendliche Trauer und unendlicher Schmerz und ja, manchmal auch Bitterkeit.“
Geschichten voller Trauer und Schmerz
Von der Trauer und vom Schmerz der Hinterbliebenen erfährt der Bundespräsident viel an diesem Vormittag. Und von ihrer Verzweiflung. Etwa von der Verzweiflung, wenn die Tochter, der Ehemann, der Vater auf der Intensivstation liegt und kein Angehöriger zu ihm darf. „Ich habe gebettelt und gefleht, ich habe gesagt, ich will bei meiner Tochter bleiben, die ist hilflos“, beschreibt Mengel die Situation, als das geistig behinderte Kind auf die Intensivstation kommt. Da ist sie gerade selbst positiv getestet worden und wird zur Quarantäne nach Hause geschickt. Erst als das Intensivbett zum Sterbebett wird, wird sie ins Krankenhaus gerufen.
In der Familie von Kirsten Grieshaber wird im vergangenen Herbst erst bei ihrem Vater die Infektion festgestellt. Er kommt auf die Intensivstation. Dann stellt sich heraus, dass sich auch ihre Mutter angesteckt hat. Schließlich liegen Mutter und Vater im selben Krankenhaus isoliert voneinander auf verschiedenen Stationen.
Keine Chance auf würdigen Abschied
„Dann waren das endlose Tage des Schreckens“, sagt Grieshaber rückblickend. Während ihre Mutter nach zehn Tagen wieder entlassen wird, stirbt der 80-jährige Vater nach dreieinhalb Wochen im Krankenhaus. Die Tochter hat ihn nicht mehr gesehen. Was sie bedrückt: „Wenn man stirbt, dann braucht man menschliche Gesichter, man braucht Berührungen, man braucht jemanden, der einem die Hand hält. Und genau das verhindert diese Krankheit.“
Anita Schedel aus Passau berichtet ebenfalls, „dass ich jeden Tag fast gebettelt habe, ob ich nicht zu meinem Mann dürfte“. Als sie es schließlich darf, sei das für sie das Zeichen gewesen, „dass ich mich verabschieden muss“. In Berlin gelingt es Aslan Mahmood nur mit Mühe, seinen Vater noch zu sehen, als dieser im Sterben liegt. Seine Mutter kann die Ärzte überreden. „Dann haben wir uns verabschiedet, ein Gebet gemacht, und nach einer Stunde ist er dann verstorben.“
„Ein besonders einsamer Tod“
„Der Tod ist ein besonderer Tod in Corona-Zeiten, weil er eben ein besonders einsamer ist“, sagt Steinmeier. Die Einsamkeit setzt sich für die Hinterbliebenen aber fort, wie der Seelsorger Andreas Steinhauser aus dem Landkreis Landshut schildert. Denn durch die Hygieneregeln bleiben sie auch in ihrer Trauer weitgehend allein.
Zeichen der Anteilnahme wie das gemeinsame Rosenkranzgebet oder Gottesdienste seien in den vergangenen Monaten kaum möglich gewesen. Trauerfeiern nur auf dem Friedhof im kleinsten Kreis aber seien sehr bedrückend. „Ich denke an eine Familie, da ist die junge Mutter verstorben, die war Kindergärtnerin. Da wäre die Kirche brechend voll gewesen, da wäre der Friedhof gefüllt gewesen mit Menschen.“ (dpa)