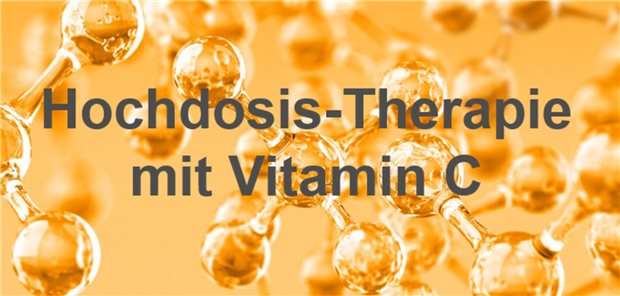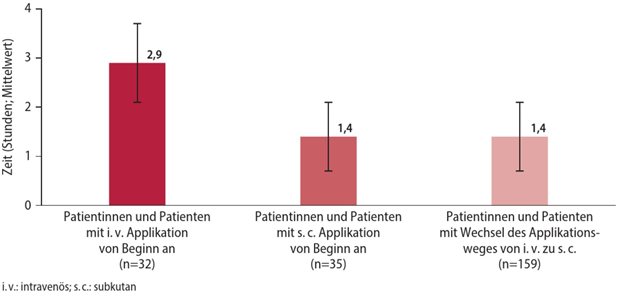Gastbeitrag von Margot Käßmann
Mit der Coronakrise umgehen – eine Frage der inneren Freiheit
Die Corona-Pandemie erschüttert die Menschen, konfrontiert sie mit der eigenen Endlichkeit, beraubt sie ihrer Existenz. Gastautorin Margot Käßmann über den Glauben und die Kraft, für sich selbst zu sorgen. Und für die Mitmenschen.
Veröffentlicht:
Hausbesuch in Zeiten der Pandemie: Eine Ärztin in Schutzkleidung misst einer mit SARS-CoV-2 infizierten Patientin den Blutdruck. Nur wer sich in der Krise selbst schützt, bleibt stark genug, um auch anderen beistehen zu können.
© Photoshot / picture alliance
„Ich kann nicht mehr, die Kinder, der Lockdown, meine Arbeit, ich bin am Ende!“
„Mein Mann entschwindet mir langsam, aber sicher. Das halte ich nicht aus. Ich kann ihn nicht regelmäßig besuchen, im Frühjahr war er wochenlang isoliert im Heim!“
„Bin eigentlich ein sehr selbstständiger Mann, habe meinen Beruf, eine schöne Wohnung, Freundeskreis. Und jetzt das. Alle Aufträge sind weggebrochen. Niemanden kann ich sehen, kein Café, keine Ausstellung besuchen. Das macht mich richtig fertig.“
„Wie können Sie noch an Gott glauben, wenn er so etwas zulässt?“
Dies sind Auszüge aus Zuschriften, die mich in der letzten Zeit erreicht haben. Mein Eindruck ist: Die seelischen Verletzungen nehmen zu. Oder sie zeigen sich, brechen auf in Zeiten der Krise.
Als Pfarrerin ist Seelsorge Teil meines Berufes. Selten war die Seelsorge so gefragt wie in den letzten Monaten. Das bestätigen Kolleginnen und Kollegen. Die Bitte um ein Gespräch am Telefon, verabredet auf Abstand in der Kirche oder dem Gemeindebüro, ist groß. Die Telefonseelsorge ist bis zum Limit ausgelastet. Viele kommen an Grenzen, die sie zum Teil bei sich selbst überraschend finden.
Die Seele: der Atem Gottes
Das hebräische Wort Nefesch, das wir im Deutschen meist mit „Seele“ wiedergeben, meint im Grunde den Atem, der uns ermöglicht, ein Lebewesen zu sein. Gott selbst, so erzählt das erste Buch Mose, blies dem Menschen den Odem ein. Die Seele ist also lebensnotwendig. Ohne sie können wir im Grunde nicht leben. Aber sie wird oft abgewertet, wenn Menschen als „Seelchen“ oder „Seele von Mensch“ bezeichnet werden. Das kommt eher diminutiv daher und wird auch vornehmlich bei Frauen benannt. Seele wird nicht wirklich ernst genommen von den „Machern“ unserer Zeit.

Dr. Margot Käßmann
© Julia Baumgart Photography
Auch in der Theologie gibt es Auseinandersetzungen um den Begriff. Im 20.Jahrhundert wurde er kritisiert. Er schien zu sehr „als Ausdruck eines verfehlten Leib-Seele-Dualismus“ (Karle). Martin Luther, der den Begriff stark gemacht hat, sah in der Seelsorge eine Aufgabe aller Christen: Andere ermutigen, ihnen Trost zusprechen, Lebenskraft vermitteln, zum Durchatmen verhelfen, darum geht es. Dabei ist Glaube nicht „Opium des Volkes“ wie Karl Marx meinte, ein Mittel, um sich angesichts einer schwierigen Lebenssituation selbst zu betäuben. Vielmehr ist Glaube mit seiner Erzählung von der Liebe Gottes, von der Hoffnung, dass es mehr gibt als das Sichtbare in dieser Welt, von den uralten Menschheitserfahrungen mit seinen Ritualen eine Ermutigung, den Realitäten nicht auszuweichen, hinzuschauen und zu fragen: Was kann ich tun?
Manchmal kann ich das erleben, erfahren, erspüren, wenn ich Menschen Segen zuspreche am Ende eines Gottesdienstes oder auch als Reisesegen. Da scheint sich manche Schulter zu straffen. Oder die Zusage der Vergebung am Buß- und Bettag, die oft Erleichterung auslöst. Auch die Zusage eines Segenswortes aus den Seligpreisungen im Rahmen des Abendmahls nehmen viele dankbar an. Diese Rituale können seelische Entlastung bringen.
Der eigene Tod ist kein Thema der Spaßgesellschaft
Wenn Menschen körperlich angegriffen sind, sehen, hören wir das, weil sie husten, schnupfen, kurzatmig sind. Ihre Erkrankung ist unseren Augen als Gebrechen sichtbar, wahrnehmbar. Wir sehen einen Gips, die Folgen einer Chemotherapie oder einer MS-Erkrankung, Laufen auf Krücken. Ist dagegen ihre Seele angegriffen, kann das sehr lange verborgen bleiben. Und es wird auch bei einem akuten Ausbruch bei weitem nicht so ernstgenommen wie eine körperliche Erkrankung.
Eine „seelische Krise“ wird eher abwertend kommentiert: Die wird sich ein bisschen „zusammenreißen“ müssen, und dann geht es schon wieder. Menschen mit seelischen Verletzungen und Erkrankungen fühlen sich ausgegrenzt und unverstanden. Und sie fühlen sich nicht nur so, sie sind es. Die Coronakrise aber strapaziert die Seelen vielfältig. Und wir müssen uns dringend um sie sorgen, damit es nicht zu sehr langfristigen Schäden kommt.
Da sind die Erschütterten. Ich denke gerade auch an Jüngere, denen die Bilder der Leichentransporte auf Armeelastwagen in Bergamo oder die Kühllastwagen mit Leichen in New York einen Schock versetzt haben. „Es könnte mich treffen!“
Die eigene Sterblichkeit wird in unserer Gesellschaft in der Regel ignoriert. Es gibt kaum noch tradierte Rituale wie den Abschied am offenen Sarg, die Gemeinschaft, die eine Familie in Trauer zum Friedhof und Begräbnis selbstverständlich begleitet samt „Leichenschmaus“ danach, der die Trauernden zurückholt in den Alltag.
Deshalb war die Reaktion so heftig, denke ich. Der Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit geht die Spaßgesellschaft in der Regel aus dem Wege. Vor Corona sprachen Soziologen von einer „Karnevalisierung“ der Gesellschaft, alles sollte Spaß machen. Jetzt hat Corona dem Spaß ein brutales Ende gesetzt.
Leere im Lockdown
Da sind die Einsamen. Es gibt diejenigen, die schon lange darunter leiden. Aber in Zeiten von Lockdowns und Shutdowns kommen diejenigen dazu, die bisher dachten, sie lebten zwar allein, aber keinesfalls einsam. Auf einmal gibt es keinen Arbeitsalltag mehr, kein Fitnessstudio ist geöffnet, Treffen mit Freundinnen sind nicht möglich. Da kann es sehr eng und sehr leer werden. Und die Seele erheblich belasten. Braucht mich überhaupt jemand? Macht mein Leben irgendeinen Sinn?
Da sind die Aggressiven. Sie wollen nicht akzeptieren, dass ihr Leben eingeschränkt wird. Wie kann das sein? Meine Freiheit wird begrenzt, daran muss jemand schuld sein! Da ist das Gefühl, „fremden Mächten“ völlig ausgeliefert zu sein. Und so verbeißen sie sich in irgendwelche Verschwörungstheorien, suchen Schuldige, die es doch geben muss. In ihnen sehe ich besonders viel Leid, weil sie ihren Zorn gegen andere wenden.
Da sind die Verunsicherten. Sie wollen ihre Mutter im Altenheim besuchen und dürfen nicht. Sie würden gern Essen gehen und alles ist geschlossen. Derart fremdbestimmt zu sein, irritiert sie, macht sie fassungslos. Da kommt Angst auf.
Da sind Menschen in einer ökonomischen Krise. Der Musiker, der seit Monaten keinen Auftritt mehr hat, die Kaffeebesitzerin, die alle Angestellten entlassen muss: Sie müssen irgendwie verkraften, dass sie auf andere angewiesen sind. Sie müssen vielleicht das Haus verkaufen, das sie gerade für ihre Familie gebaut haben. Existenzen, Lebenspläne sind infrage gestellt und auch die eigene Wertigkeit.
Den Nächsten lieben wie sich selbst
Als Jesus einen frommen Juden fragt, was das höchste Gebot sei, erklärt der: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst“ (Lukas 27, 10). Damit fasst er alle Gebote zusammen. Als Christin bin ich überzeugt, das ist auch in diesen Zeiten ein guter, nach vorn weisender Ansatz für unser Verhalten. Gebote sind ja im Grunde Hilfestellungen, Geländer, die im Leben Orientierung geben.
Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele ist eine Glaubensfrage, aber auch Lebenshaltung. Sie drückt aus, dass ich mich einerseits einem anderen gegenüber, einer anderen Macht oder auch Instanz verantwortlich weiß. Ich lebe nicht nur für mich selbst. Das muss ja gar nicht bedrohlich daherkommen wie bei den Bildern von einem strafenden Donnergott, die manches Jahrhundert gut kannte.
Nein, es ist eine Frage der inneren Freiheit: Ich reflektiere bewusst, wie ich lebe, rede, handle. Da ist nichts zu vertuschen, zu verbergen. Und da Liebe immer eine Doppelbewegung ist, weiß ich mich von dieser Liebe Gottes, die mir zugesagt wird, getragen und gehalten. Und will sie weitergeben, ganz praktisch. Die Theologin Dorothee Sölle schrieb einmal, wir brauchten die gute Schöpfungsmacht Gottes, aber Gott braucht auch uns: „Gott hat nur unsere Hände.“
Agapé statt eros
Den Nächsten lieben, da geht es um einen offenen Blick für andere. Wo ist jemand besonders einsam? Wer braucht gerade Ermutigung. Da geht es um Solidarität durchaus auch ganz praktisch: Bei wem bestelle ich die Blumen, das Buch, das Geschenk, damit der Einzelhandel nicht durch Corona vollends vor dem Onlinehandel in die Knie geht und unsere Innenstädte verändert?
Liebe muss man dabei natürlich differenziert betrachten. Es ist nicht von eros die Rede, sondern von agapé, dem Respekt vor anderen. Dass es nicht immer einfach ist, den aufrechtzuerhalten, wissen wir alle. Aber das ist die einzige Lebenshaltung, die solidarisches Miteinander ermöglicht.
Und ja, da ist stets Eigeninteresse im Spiel. Das finde ich so genial an der Antwort auf die Frage, welches von den 613 Geboten der Überlieferung denn das größte sei. Wir dürfen uns auch selbst lieben. Das ist doch eine wunderbare Zusage! Wir können, ja sollen uns fragen, was uns guttut. Das meint nicht Egoismus, der sich gegen andere wendet, sie missachtet, sondern eben eine Spielart der Achtsamkeit in diesem Falle auf mich selbst.
Gott über alle Dinge lieben heißt für mich: Ja, es gibt Grenzerfahrungen. Für unsere Generation, für unsere Generation in anderen Ländern noch viel mehr. Aber auch für Generationen vor uns und in der biblischen Erzähltradition. Davon lässt sich lernen. Glaube stellt uns in eine Reihe mit anderen, wir lernen aus der Erfahrung unserer Väter und Mütter im Glauben.
Die Kirche war seit den ersten Gemeinden, von denen die Apostelgeschichte berichtet, eine Solidargemeinschaft. Ja, gewiss, eine mit vielen Fehlern, weil sie von Menschen gestaltet wird. Die Bibel hat da übrigens ein sehr realistisches Menschenbild. Aber sie hat stets Trost vermittelt, indem sie in der Zuwendung zu den Mitmenschen sichtbare Zeichen der Liebe Gottes setzt.
Wie will ich leben?
Der Liebe, von der für Christinnen und Christen Jesus erzählt und sie durch seine Person zugänglich macht. Der Menschenliebe Gottes, von der aber bereits die jüdische Tradition erzählt, in der Jesus als Jude aufgewachsen ist.
Als Beispiel: „Seid getrost und unverzagt“, sagt Mose dem Volk Israel zu. Er wird das gelobte Land nicht mehr betreten dürfen, hat Gott ihm gesagt. Er darf nur noch auf einen Berg steigen und es in der Ferne sehen. Und das, nachdem er das Volk 40Jahre durch die Wüste geführt hat, könnte als ungerecht empfunden werden.
Aber Mose hadert nicht. Seine Seele ist im Reinen mit Gott, mit seinem wahrhaftig nicht geraden oder einfachen Lebensweg, seiner Verantwortung, die er auf dieser Etappe der Geschichte wahrgenommen hat. In aller Freiheit kann er Abschied nehmen und den Nachfolgenden Mut und Zuversicht zusprechen. So würde ich selbst eines Tages auch gern Abschied nehmen und sterben! Und genau darüber zu reden, ist in Zeiten einer Pandemie noch wichtiger als sonst! Wie wollen wir sterben? Diese Frage zu stellen, kann Gespräche vertiefen, zur Sorge für die Seele werden.
In unserer Zeit ist die Angst vor dem Tod besonders groß, weil wir ihm selten direkt begegnen. Gestorben wird in Heimen oder Krankenhäusern, bestenfalls im Hospiz, selten Zuhause. Aufbahren, Aussegnen, Abschied am offenen Sarg, die Rituale der Bestattung sind vielen fremd.
Dabei bieten auch sie Geländer. So liegt auch eine Chance darin, mit dem Tod konfrontiert zu sein durch Bilder und Zahlen und zu reflektieren: Wie will ich sterben? Aber eben auch: Wie will ich leben, damit ich am Ende in Frieden Abschied nehmen kann wie Mose? Schon der Psalmbeter bittet: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ (90,12)
Wer sich engagiert, ist glücklicher
Ich denke nicht, dass die Pandemie Menschen grundsätzlich verändert. Aber es zeigt sich wie stets in der Geschichte, dass eine Krise das Beste und das Schlechteste in Menschen hervorbringt. Die einen nähen Masken, schreiben Karten an Einsame in Pflegeheimen. Die anderen pöbeln, bedrohen andere, stehlen Sterilium von einer Kinderkrebsstation. Da hat übrigens schon die Bibel ein sehr realistisches Menschenbild.
Es ist aber erwiesen, dass diejenigen, die sich um andere sorgen, sich für andere engagieren, die glücklicheren Menschen sind. Solidarität und Eigenverantwortung sind eben keine Gegensätze! Ich denke, die genannte biblische Passage zum höchsten Gebot belegt eine tiefe Einsicht, die mir auch ganz und gar säkulare Therapeutinnen und Therapeuten bestätigen: Nur wer für sich selbst gut sorgen kann, hat auch Kraft und Freiheit, für andere zu sorgen. Anders herum: Ich kann mich gut für andere einsetzen, wenn mein Selbstwertgefühl stimmig ist.
Insofern ist der biblische Zusammenhang von Selbst- und Nächstenliebe auch heute relevant. Es geht angesichts einer solchen Lage wie dieser Pandemie-Erfahrung gesellschaftlich um eine Balance zwischen Eigenverantwortung und Solidarität. Denn Eigenverantwortung ist dringend geboten.
Nicht Furcht, sondern Besonnenheit
Zum einen geht es darum, für sich selbst zu fragen: Wie kann ich mich verantwortlich verhalten? Der Staat kann Einschränkungen anordnen, um die Pandemie einzudämmen, aber die eigene Haltung dazu muss der Mensch finden.
Zum anderen geht es darum, nicht wie gelähmt auf die Situation zu schauen, sondern zu fragen: Wie kann ich für mich sorgen, was können Perspektiven sein? Es ist klar, dass dabei der Resilienzfaktor eine Rolle spielt. Die einen werden sagen: Ich nehme Kontakte auf, in dieser Einsamkeit bleibe ich nicht stecken. Die anderen werden abgleiten in eine Depression. Hier gilt es, Besonnenheit zu stärken.
Im zweiten Timotheusbrief in der Bibel heißt es: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ (2,7) Mir scheint das wegweisend als Zusage: Die Angst muss nicht die Oberhand gewinnen. Ich kann eigene Kraft finden. Aber auch die Kraft zur Liebe anderer.
Genau da kann Solidarität greifen. In Umfragen erklärt rund die Hälfte der Deutschen, sie wolle als Folge der Pandemie-Erfahrung achtsamer leben. Achtsamkeit ist ein wunderbarer Begriff. Weil er Solidarität verbindet mit dem Blick auf die Bedürftigkeit anderer und so nicht Pose bleibt, sondern aktiviert.
Insofern steckt in den Grenzerfahrungen des Jahres 2020 auch Hoffnungspotenzial. Zurückgeworfen auf sich selbst, reflektieren Menschen neu, was für sie entscheidend ist. Und das sind am Ende die Beziehungen zu anderen, die keinen Marktwert haben.
Solidarität belebt, schenkt Energie
Wer für andere Sorge trägt, kommt besser durch die Coronakrise. Die einen backen Plätzchen, die anderen schreiben Briefe, wieder andere hören zu oder besuchen sich auf einen Kaffee oder Spaziergang. Und genau dadurch stabilisieren sie sich auch selbst angesichts von Kontaktregeln und Shutdown der Begegnungsmöglichkeiten im Restaurant oder Café, im Kino oder im Theater.
Die Lebenserfahrung zeigt: Solidarität belebt, schenkt Energie, stärkt das Gefühl von Miteinander und positives Denken. Und sie hängt mit Eigenverantwortung durchaus zusammen: Wer für sich selbst sorgt, ohne egoistisch zu denken, hat auch die Kraft für den Blick auf andere. Und dadurch entsteht eine Erfahrung von Freiheit!
„Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes“, singt die schwangere Maria, als sie ihre Verwandte Elisabeth besucht. So erzählt es der Evangelist Lukas. Sie hat gewiss Sorgen, wie jede Schwangere. Aber sie kann sich freuen, Glück empfinden. Es ist wichtig, Seelsorge nicht nur auf die schweren Zeiten des Lebens zu beziehen. Es tut der Seele gut, Glück zu empfinden.
Meine Großmutter hatte zwei Weltkriege durchlebt. Am Ende musste sie 1946 alles zurücklassen und ohne ihren Mann in der Fremde in Hessen völlig neu beginnen. Und doch sehe ich sie am Herd stehen und aus voller Kehle singen: „Du, meine Seele, singe.“
Ihre Seele hatte offensichtlich keinen Schaden genommen. Sie hatte sich in allem Schmerz und Leid von Gott gehalten gewusst. Insofern ist auch Glaube ein Resilienzfaktor. Denn er erzeugt Dankbarkeit für das Gute und ist Kraftquelle für schwere Zeiten.
Dr. Margot Käßmann war von 2009 bis 2010 Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. 1958 in Marburg geboren, studierte sie unter anderem in Tübingen und Edinburg Evangelische Theologie. Von 1994 bis 1999 war sie als erste Frau in diesem Amt Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags und bis 2010 Bischöfin der Landeskirche Hannover.