Künstliche Intelligenz und E-Patientenakte
„In Deutschland sind wir Mediziner manchmal einfach zu vorsichtig“
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz: Wie wirken sich die abstrakten Begriffe auf den klinischen Alltag aus? Darüber berichtet Professor Michael Forsting vom Uniklinikum Essen. Ein Plädoyer für eine Digitalisierung, die auf Diagnose, Therapie und Arzt-Patienten-Verhältnis einzahlt.
Veröffentlicht: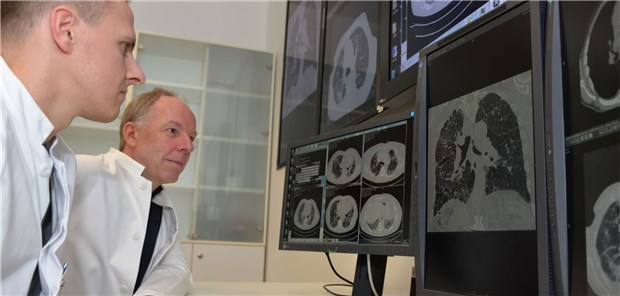
Professor Michael Forsting (r.) zählt im Arbeitsalltag auf digitalisierte Prozesse und den Einsatz Künstlicher Intelligenz.
© Universitätsmedizin Essen
Essen. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, die elektronische Patientenakte – große Konzepte, die mitunter auf noch größere Skepsis stoßen. Auch am Universitätsklinikum Essen. Anfangs jedenfalls. Mittlerweile hat sich die anfängliche Skepsis gelegt, wie Professor Michael Forsting am Freitag am Rande des diesjährigen ETIM (Emerging Technologies in Medicine)-Kongresses in Essen aus seinem Klinikalltag berichtet.
Forsting ist Leiter der Klinik für Diagnostische Radiologie des Uniklinikums Essen und nutzt Künstliche Intelligenz (KI) im Arbeitsalltag unter anderem zum Tumor-Screening, für Verlaufsuntersuchungen zum Wachstum von Tumoren und zum Aufspüren von Metastasen.
Umstellung verunsichert zunächst
Das Universitätsklinikum Essen befindet sich derzeit in der Umstellung zu einem sogenannten „smart hospital“; es hat sich die Digitalisierung entsprechend groß auf die Fahne geschrieben. Basis ist die elektronische Patientenakte, in der die Daten aller stationär behandelten Patienten des Klinikums digital vorliegen. Über ein zentrales Patientendatenmanagementsystem kann das medizinische Personal auf Befunde, Diagnosen und Therapiepläne zugreifen.
Für Ärzte bedeutete das aber auch eine Umstellung: „Ärztliche Anordnungen erfolgen nicht mehr auf Zuruf an die Krankenschwester, sondern werden von den Ärzten direkt in die elektronische Akte eingetragen“, erklärt Forsting. Anfangs sei das auf Kritik gestoßen, da das System beispielsweise nur erlaubt, dass Mediziner ärztliche Anordnungen eintragen. „Im ersten Moment ein Mehraufwand, aber in erster Linie dient das der Patientensicherheit.“
„Am Anfang ist jede Umstellung erst einmal blöd“, berichtet Forsting, nicht ohne zu betonen, dass die elektronische Patientenakte „mehr Nutzen als Schaden“ bringt. Die Kollegen seien offen gegenüber der Umstellung, auch wenn sie hier und da mit einem unzufriedenen Stöhnen begleitet worden sei.
Alle Ärzte können auf die Akten zugreifen
Kritisch seien in erster Linie die Medienbrüche, die bei der Umstellung von analog auf digital entstehen. Ist die Umstellung aber einmal komplett vollzogen, überwiegen die Vorteile – auch aus Patientensicht. „Es ist im Sinne der Patienten, dass alle Ärzte im Klinikum auf die elektronische Patientenakte zugreifen können. Es ergibt keinen Sinn, einem Arzt Informationen vorzuenthalten.“
Die Patienten scheinen die Auffassung zu teilen, zeigen sich aufgeschlossen gegenüber der elektronischen Erfassung ihrer Daten. „Einen kranken Patienten interessiert in erster Linie seine Heilung, mehr nicht. Und die Therapie wird sicherer und transparenter für alle“, sagt Forsting.
In puncto Datensicherheit macht er sich keine Sorgen: Die Patientendaten seien sicher auf verschiedenen Servern gespeichert und zudem für Hacker „kein interessantes Angriffsziel. Sie wollen eher unser Abrechnungssystem lahmlegen, als an Patientendaten kommen“, sagt Forsting.
Deutsche zu vorsichtig?
Die Ablehnung vieler Mediziner gegenüber der Digitalisierung im Gesundheitswesen sieht Forsting skeptisch: „In Deutschland sind wir manchmal einfach zu vorsichtig. Wir können nicht für jedes Szenario einen Plan haben, manchmal müssen sich die Dinge im Arbeitsalltag ergeben. Letztlich geht es um die Verbesserung der Versorgung – und da helfen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.“ Veränderungen seien normal – insbesondere in der Medizin, die sich ständig weiterentwickelt.
Zum „smart hospital“ zählen auch der Einsatz und die Entwicklung Künstlicher Intelligenz – also von Algorithmen, die Mediziner in ihrem Arbeitsalltag unterstützen sollen. „Wir haben da einen ganz pragmatischen Einsatz“, erklärt Forsting und führt als Beispiel unter anderem eine erhebliche Reduktion von Kontrastmitteln im CT an oder auch dem gänzlichen Verzicht darauf im MRT.
Zudem könnten die Messzeiten stark reduziert werden, da die Algorithmen darauf trainiert seien, Kontraste automatisch anzupassen. „Wir haben zielgerichtet trainierte Systeme, die uns im Arbeitsalltag helfen und damit zur Qualitätssicherung beitragen“, so Forsting weiter. Dafür würden die Algorithmen regelmäßig geprüft, um sicher zu sein, dass sie richtig arbeiten. Denn der Wandel ist nur so gut, wie die Menschen, die ihn gestalten.















