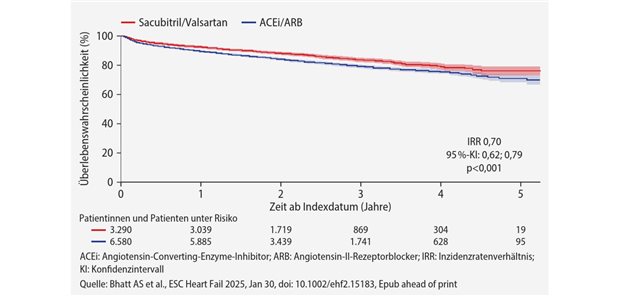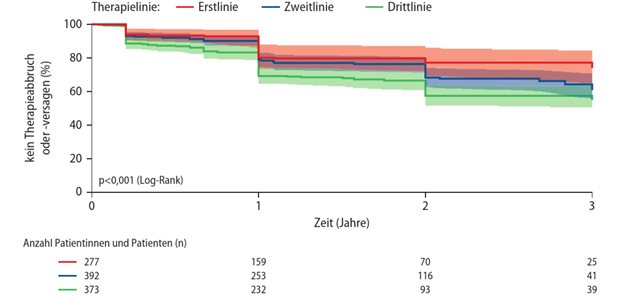DGIM-Empfehlungen
Internisten definieren Inhalte für E-Patientenakte
Wie sehr die Digitalisierung in den Alltag der Ärztinnen und Ärzte drängt, zeigt sich auch darin, dass immer mehr Fachgesellschaften und Berufsverbände eigene Lösungen und Konzepte entwickeln. Jetzt hat die DGIM Empfehlungen für Inhalte der E-Patientenakte vorgelegt.
Veröffentlicht:
Alle Ärztinnen und Ärzte an einem Ort, um auf Patientendaten zuzugreifen? Mit der ePA könnten die Daten für alle, die Zugriff haben, problemlos ortsunabhängig erreichbar sein. Bei den meisten Patienten ist das allerdings noch Zukunftsmusik.
© Robert Kneschke / stock.adobe.com
Wiesbaden. Wie kann die elektronische Patientenakte (ePA) den Versorgungsalltag von Ärztinnen und Ärzten in Klinik und Praxis erleichtern? Mit dieser Frage hat sich die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) intensiv beschäftigt und jetzt ein Papier mit „Empfehlungen für Inhalte der ePA aus Sicht der Inneren Medizin“ vorgelegt.
Die Fachgesellschaft sieht „großes Potenzial der ePA“, um die Abläufe in der Gesundheitsversorgung zu verbessern, und beklagt, dass die Einführung der ePA immer noch stocke: Gerade einmal 550.000 Personen verfügten bisher über eine ePA, schreibt die DGIM in einer Mitteilung zu dem Papier.
„Sobald die ePA in der Breite bei den Versicherten ankommt, kann sie die medizinische Versorgung deutlich verbessern“, erklärt Privatdozent Dr. Sebastian Spethmann, Sprecher der DGIM-Arbeitsgruppe Digitale Versorgungsforschung, der das Paper federführend verfasst hat.
DGIM-Empfehlungen
Internisten definieren Inhalte für E-Patientenakte
Ein Beispiel: „Dem Rettungsdienst, den Kolleginnen und Kollegen in der Notaufnahme oder der Intensivstation fehlen oft wichtige Informationen zum Gesundheitszustand oder der Krankengeschichte von Patientinnen und Patienten“, so Spethmann, der Kardiologe am Deutschen Herzzentrum der Charité ist, laut Mitteilung.
In diesem Fall könnte ein in der ePA hinterlegter Notfalldatensatz, der etwa Informationen zu Vorerkrankungen, Dauermedikationen oder Allergien enthält, über Leben und Tod entscheiden.
Vorbefunde sind leichter zugänglich
Weitere Beispiele, in denen die Nutzung der ePA im Versorgungsalltag Vorteile bringen könnte, sind laut DGIM-Papier die elektive, erstmalige ambulante Behandlung unbekannter Patientinnen und Patienten, die einrichtungsübergreifende Behandlung chronisch Kranker sowie die Behandlung von Patienten mit seltenen und mit malignen Erkrankungen, die häufig ebenfalls einrichtungsübergreifend laufen müssten.
Die ePA bringe in diesen Fällen vor allem dadurch Vorteile in der Versorgung, dass der Aufwand, Vorbefunde zu erheben und einen Überblick über die Krankheitssituation der Patientinnen und Patienten zu gewinnen, erheblich reduziert wird.
Die Arbeitsgruppe der DGIM macht zudem Vorschläge, zu welchen Themenfeldern Daten in der ePA gespeichert werden sollten. Dazu zählen laut DGIM persönliche Erklärungen wie der Organspendeausweis, die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht oder aber Medikationspläne, der Impfpass sowie Laborbefunde und Arztbriefe.
„Unsere Überlegungen gehen von der internistischen Praxis und ihren Anforderungen aus. Wir möchten damit einerseits zur Diskussion anregen, welche Daten in der ePA erfasst werden und wie diese darin aufbereitet werden sollten“, erklärt Professor Claus Vogelmeier, Sonderbeauftragter für Digitalisierung im Vorstand der DGIM und Vorsitzender der DGIM-Kommission Digitale Transformation der Inneren Medizin, laut Pressemitteilung.
Nur strukturierte Daten helfen wirklich weiter
Besonders hebt die DGIM in ihrem Papier die Notwendigkeit der Strukturierung der Daten in der ePA hervor, damit es nicht zu Mehrdeutigkeiten kommen könne und damit die Daten auch möglichst automatisiert weiterverarbeitet werden könnten. Dies bedeute, dass, wo immer möglich, standardisierte Kodierungssysteme genutzt werden, zum Beispiel ICD-10 (-11) für Diagnosen, OPS für Operationen, SNOMED-CT für eine übergreifende Kodierung sowie LOINC für Laborwerte.
Auch Metadaten wie Erstellungszeitpunkt, Urheber etc. sollten immer mit den Daten erhoben werden. Einen Großteil dieser Arbeit zur Kodierung können Praxisverwaltungssysteme und Krankenhausinformationssysteme übernehmen.
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen – und davon sei die ePA ein wichtiger Teil – sei dringend notwendig und überfällig, wird DGIM-Generalsekretär Professor Georg Ertl in der Mitteilung zitiert. Alle Beteiligten müssten jedoch anerkennen, dass die Umstellung von der Papier- auf die elektronische Akte für Ärztinnen und Ärzte zunächst mit erheblichen zeitlichen und organisatorischen Mehraufwänden verbunden sein wird, so der Kardiologe aus Würzburg. Dies müsse entsprechend Berücksichtigung finden. In dem Papier wird daher eine „angemessene Vergütung des antizipierten Mehraufwands“ gefordert.
Auch der Einführungsaufwand beschäftigt die Fachgesellschaft – er soll möglichst gering gehalten werden: „Die ärztliche Zeit gehört zuallererst den Patientinnen und Patienten“, so der DGIM-Vorsitzende Professor Ulf Müller-Ladner laut Mitteilung. Da im Alltag in Klinik und Praxis die Kapazitäten für eine Beta-Testung der Soft- und Hardware fehlten, müsse die ePA in der Einführungsphase bereits nahezu serienreif sein. Dies sei für eine möglichst große Akzeptanz der ePA in der Ärzteschaft entscheidend. (ger)
Diese Informationen sollten nach Vorschlag der DGIM in der ePA hinterlegt sein:
Notfalldatensatz (NFD) bzw. Elektronische Patientenkurzakte (ePKA)
- Größe, Gewicht
- Vorerkrankungen (mit ICD 10)
- Aktuelle Dauermedikation (inkl. Bedarfsmedikation)
- Allergien (mit klinischen Angaben) und Unverträglichkeiten
- Angaben zu Implantaten
- Pflegestufe
- Einschluss in ein Patientenprogramm, z.B. DMP
- Kontaktinformationen Angehörige, Pflegeeinrichtung, behandelnde Ärzt:innen/Einrichtungen
Datensatz persönliche Erklärungen (DPE)
- Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuung (Kontaktdaten der Pflegeeinrichtung inkl. Pflegebögen), ggf. vorhandener Pflegegrad
- Patientenverfügung
- Organspendeausweis
Aktuelle Medikation
- Bundeseinheitlicher Medikationsplan (BMP), elektronischer Medikationsplan (eMP) und Angabe über Indikationen und Medikationshistorie
- Ggf. Interaktionscheck-Option
Impfdokumentation
- Impfpass
Briefe und Berichte
- Stationäre Behandlung
- Briefe ambulante Fachärzte
- Physiotherapeuten, andere Heilberufe
Befunde von
- Labor-Untersuchungen (z.B. Klinische Chemie, Hämatologie etc.)
- apparativen Untersuchungen (z.B. EKG, Lungenfunktion etc.)
- bildgebenden Verfahren (z.B. CT, MRT, Ultraschalluntersuchungen etc.)