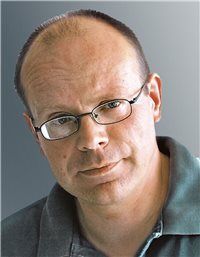Gesundheitswirtschaft
Medtech-Unternehmen unter Zugzwang
Stetiges Marktwachstum aber auch steigender Investitions- und Erneuerungsbedarf: Die deutsche Medtech-Industrie stößt zunehmend an die Grenzen ihrer klein- und mittelständischen Strukturen.
Veröffentlicht:
Intensivmedizinischer Maßnahmen bedarf die deutsche Medtech-Industrie noch nicht – gänzlich entspannt ist die Lage aber auch nicht.
© bvmed
Berlin. Regulatorische Herausforderungen, neue Techniktrends, wachsender Wettbewerb in globalen Märkten – und jetzt auch noch die Corona-Krise: Der Konsolidierungsdruck auf die heimische Medizinprodukteindustrie lässt nicht nach. „Mittelständische Unternehmen müssen ihr Geschäftsmodell überprüfen, um auf fortschreitenden Preisverfall und zunehmende Digitalisierung vorbereitet zu sein“, so das Fazit einer neuen Branchenstudie („Medizintechnik 2020“) des Genfer Beratungsunternehmens Clairfield International und der Kölner Rechtsanwaltsgesellschaft Luther unter Beteiligung mehrerer universitärer und privater Experten, unter anderem des Medtech-Verbands (BVMed).
Die Studienautoren stellen der Branche allerdings auch Chancen in Aussicht: Bis 2024 werde der globale Medizintechnikmarkt von 457 Milliarden Dollar (in 2019) auf dann 595 Milliarden Dollar zulegen. Insbesondere die Robotik verspreche Anbietern exponentielles Wachstum mit Steigerungsraten von 20 Prozent pro Jahr“, heißt es. Als weitere wichtige Techniktrends werden Künstliche Intelligenz, Big Data, Sensorik, E-Health, patientenindividuelle Medizintechnik und vernetzte OP-Säle identifiziert.
Lokomotive Fernost
Um langfristig Erfolg zu haben, sei jedoch „eine digitale Ausrichtung der Geschäftsmodelle“ unerlässlich. Deutsche Unternehmen dürften sich nicht auf ihren technischen Fertigkeiten ausruhen, „sondern müssen massiv in Software und Methodik wie KI und Big Data investieren“. Zugleich drängten branchenfremde Unternehmen in den Markt – beispielhaft werden Automobilzulieferer genannt –, was die angestammten Player zusätzlich in Zugzwang bringe.
Stärkster Motor des globalen Branchenwachstums ist der Studie zufolge Asien. Vor allem die dortige, stetig breiter werdende Mittelschicht sorge für Nachfrageimpulse, womit „Europa von Platz 2 der wichtigsten Medtech-Märkte“ verdrängt werde. Medizinproduktehersteller und Medizintechnikanbieter müssten sich daher auf den Emerging Markets und insbesondere in Asien „frühzeitig positionieren, um eine Führungsrolle oder zumindest überhaupt eine Rolle einnehmen zu können“, heißt es weiter. Dass die heimische Industrie angesichts dieser vielfältigen Herausforderungen politische Unterstützung erwartet, versteht sich von selbst.
Blick nach Berlin
Nicht zuletzt von der Pandemie und den anfänglichen Engpässen bei der Marktversorgung mit medizinischer Schutzausrüstung erhofft sich die Branche jetzt noch mehr Gehör in Berlin. „Wir benötigen einen gesamtgesellschaftlichen Dialog über den Medtech-Standort Deutschland und seine systemrelevante Infrastruktur“, so der BVMed-Vorsitzende Dr. Meinrad Lugan in einem der Studie anhängenden Interview.
Lugan erneuert damit seine Forderung nach einem „Medtech-Dialog zwischen der Medizinprodukte-Branche, den maßgeblichen Regierungsressorts und unter Beteiligung des Deutschen Bundestages“. Dabei solle es unter anderem um Themen gehen wie Bürokratieabbau, staatliche Förderprogramme für Mittelständler zur Anpassung an das neue europäische Medizinprodukterecht (MDR), Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel oder die Entwicklung neuer branchenspezifischer Berufsbilder.
Rekordumsatz 2019
Nach jüngsten Branchenzahlen (BVMed, Spectaris, Statistisches Bundesamt) steht die inländische Medtech-Industrie für über 200 000 Arbeitsplätze in 1380 Betrieben mit mehr als 20 Mitarbeitern und weiteren 13 000 Betrieben mit weniger als 20 Köpfen. 93 Prozent der Unternehmen beschäftigen weniger als 250 Mitarbeiter.
2019 erzielten die deutschen Branchenplayer mit 33,4 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert im Zehnjahresverlauf; 2009 betrug der Branchenumsatz erst knapp 20 Milliarden Euro. Mit inländischer Nachfrage wurden vergangenes Jahr 11,5 Milliarden Euro umgesetzt (+9,3 Prozent), im Export 21,9 Milliarden (+10,9 Prozent), was einer Exportquote von 65 Prozent entspricht.