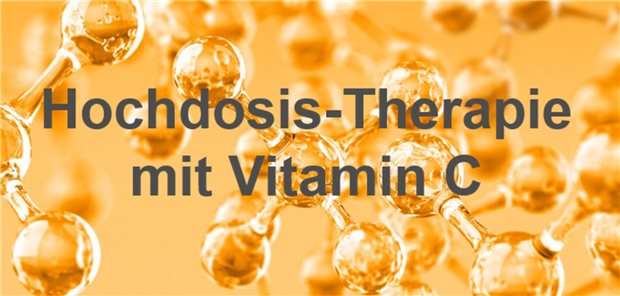Diskriminierung
Große Versorgungslücken bei trans und nicht-binären Menschen
Eine Studie der Deutschen Aidshilfe und des Robert Koch-Instituts zur sexuellen Gesundheit von trans und nicht-binären Menschen deckt eklatante Versorgungslücken auf.
Veröffentlicht:
Versorgung von trans und nicht-binären Menschen muss sich verbessern, zeigt eine Studie des RKI und der Deutschen Aidshilfe.
© adragan / stock.adobe.com
Berlin. Medizinische Einrichtungen und Beratungsstellen zu Fragen der sexuellen Gesundheit in Deutschland sind auf trans und nicht-binäre Menschen nicht ausreichend vorbereitet. Dabei unterliegen diese besonderen Risiken und sind zum Beispiel deutlich häufiger von HIV betroffen als der Durchschnitt der Bevölkerung (0,7 statt 0,1%).
Das sind die zentralen Ergebnisse der Studie „Sexuelle Gesundheit und HIV/STI in trans und nicht-binären Communitys“ der Deutschen Aidshilfe und des Robert Koch-Instituts (RKI), wie es in einer Mitteilung der Deutschen Aidshilfe heißt.
Erstmals gesicherte Daten zur sexuellen Gesundheit trans und nicht-binärer Menschen
Damit liegen erstmals Daten und wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse zur sexuellen Gesundheit dieser vielfältigen Gruppen in Deutschland vor.
„Mit Blick auf HIV und Geschlechtskrankheiten ist ein leichter Zugang zu kompetenten Angeboten für Beratung, Tests und Behandlung unverzichtbar. Trans und nicht-binäre Menschen können sich darauf in Deutschland noch nicht verlassen. Sie müssen mit Unwissenheit und Diskriminierung rechnen – und damit, dass sie schlicht nicht mitgedacht werden. Das muss sich dringend ändern!“, sagt Sylvia Urban vom Vorstand der Deutschen Aidshilfe.
Für die genannte Studie befragte das Robert Koch-Institut mehr als 3.000 Menschen mit einem Online-Fragebogen. Die Deutsche Aidshilfe sprach in Workshops und Interviews mit 59 Personen ausführlich über ihre Erfahrungen.
Die gemeinsame Studie wurde partizipativ durchgeführt: Die Zielgruppen waren in jede Phase des Forschungsprojektes eingebunden, die Forschenden gehörten teilweise selbst zu den erforschten Communitys.
Erhöhte gesundheitliche Risiken
Die Ergebnisse bestätigen, was in der internationalen Forschung bereits bekannt war: Trans und nicht-binäre Menschen sind generell erhöhten gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Psychische Belastungen entstehen etwa durch Diskriminierungserfahrungen und Stigmatisierung, aber auch, weil der eigene Körper oder bestimmte Körperteile als unpassend empfunden werden (Geschlechtsdysphorie), heißt es in der Mitteilung.
Sexualität sei für trans und nicht-binäre Menschen ein besonders sensibles Thema. Eine wichtige Rolle spiele für viele der Aushandlungsprozess, welche Art von Sexualität stattfinden soll und welche Körperteile beteiligt sein dürfen und welche nicht. Das sexuelle Wohlbefinden werde oft beeinträchtigt durch Angst vor Ablehnung und Diskriminierung sowie verinnerlichte Abwertung und Erwartungshaltungen, so die Deutsche Aidshilfe.
Beratung von trans und nicht-binären Menschen müsse daher psychosoziale Komponenten besonders berücksichtigen und dabei unterstützen, ein positives Selbstbild zu entwickeln, die eigene Sexualität zu erkunden und zu entwickeln sowie Bedürfnisse zu äußern und durchzusetzen.
Gesundheitssystem ohne Kenntnisse
Trans und nicht-binäre Menschen würden jedoch auf ein Gesundheitssystem treffen, das sich noch immer fast ausschließlich an der überkommenen Einteilung in lediglich zwei Geschlechter orientiert – vom Aufnahmebogen über Beratung und Medikation bis zur Abrechnung.
Lediglich 32% gaben laut Studie an, dass bei ihrer letzten Beratung zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen der selbstgewählte Name, die geschlechtliche Identität und das gewünschte Pronomen erfragt wurden. Ein strukturelles Hindernis bestehe zum Beispiel, wenn Gynäkologinnen und Gynäkologen die Gebärmutterhalskrebsvorsorge nicht abrechnen können, weil bei der Krankenkasse das Geschlecht „männlich“ gespeichert ist, so die Aidshilfe.
„Auf trans und nicht-binäre Menschen sind weder Mediziner*innen noch Berater*innen ausreichend vorbereitet. Sie fühlen sich im Medizinsystem deswegen oft nicht willkommen und gesehen, sondern gefährdet. Wenn Ratsuchende zunächst ihre Berater*innen aufklären müssen, ist das kontraproduktiv und inakzeptabel“, sagt Projektleitung Chris Spurgat.
Wenig Vertrauen führt zu Vermeidung
Nicht spezialisierte Angebote würden dementsprechend häufig mit Skepsis betrachtet und mit Erwartungen von Diskriminierung, fehlender Sensibilität und mangelndem Fachwissen zu trans und nicht-binären Körpern verknüpft.
17% der online Befragten gaben an, sie hätten aus Angst vor Diskriminierung bereits auf bestimmte Leistungen verzichtet, etwa auf Beratung zu Fragen sexueller Gesundheit oder Tests auf HIV und andere sexuelle übertragbare Infektionen. Das kann lebensgefährliche Folgen haben, etwa, wenn HIV-Infektionen unbehandelt bleiben oder Krebserkrankungen erst spät entdeckt werden.
Um etwas an der desolaten Situation zu verändern, gibt der Abschlussbericht Empfehlungen für eine bessere Versorgung für trans und nicht-binäre Menschen. (eb)