Posttraumatische Belastungsstörung
Antibiotikum schwächt traumatische Erinnerungen ab
Nicht immer lassen sich die Folgen eines traumatischen Erlebnisses mit einer Psychotherapie erfolgreich behandeln. Wissenschaftler aus Zürich arbeiten daran, das Traumagedächtnis stattdessen medikamentös zu beeinflussen.
Veröffentlicht: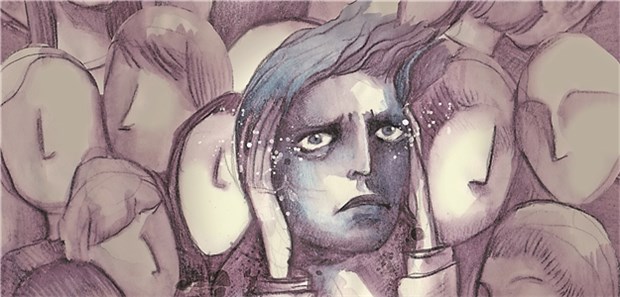
Immer und immer wieder durchleben PTBS-Betroffene traumatische Erlebnisse.
© Malombra76/Getty Images/iStockphoto
ZÜRICH. Ein möglicher neuer Ansatz für die Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung: Nach Einnahme des Antibiotikums Doxycyclin erinnern sich Studienteilnehmer deutlich weniger an ein unangenehmes Ereignis. Dies belegen die Experimente eines Forscherteams der Psychiatrischen Universitätsklinik und der Universität Zürich (Molecular Psychiatry 2017; online 4. April).
Körperliche Gewalt, Krieg oder auch eine Naturkatastrophe können eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) auslösen. Betroffene durchleben das belastende Ereignis immer wieder – durch plötzlich einschießende Erinnerungen oder als sich wiederholende Albträume. Nicht immer kann diese seelische Verletzung mit einer Psychotherapie erfolgreich behandelt werden. Daher suchen Wissenschaftler seit langem nach einem Weg, das Traumagedächtnis medikamentös zu beeinflussen, berichtet die Universität Zürich in einer Mitteilung. Im Tiermodell erprobte Möglichkeiten waren beim Menschen bisher nicht anwendbar oder nicht wirkungsvoll genug. Nun testeten Forscher der Psychiatrischen Universitätsklinik und der Universität Zürich erfolgreich ein Medikament aus der Infektiologie, das bei Menschen die Erinnerung an ein negatives Erlebnis deutlich abschwächt.
Gedächtnisbildungs-Enzym gehemmt
Das Team unter der Leitung von Dominik Bach, UZH-Professor und Arzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik, stellt einen neuen Ansatz vor. Es untersuchte, wie sich die Hemmung eines für die Gedächtnisbildung wichtigen Enzyms auf traumatische Erinnerungen auswirkt. Erst seit jüngster Zeit ist aus Laborversuchen bekannt, dass für die Gedächtnisbildung Eiweiße aus dem Raum zwischen Nervenzellen, der Extrazellulärmatrix, benötigt werden. Diese Enzyme, sogenannte Metalloproteinasen, kommen im gesamten Körper vor und sind etwa bei der Entstehung von Herzerkrankungen und verschiedenen Krebsarten beteiligt. Das Antibiotikum Doxycyclin hemmt die Aktivität dieser Enzyme und ist für mehrere dieser Erkrankungen bereits erprobt. Die UZH-Wissenschaftler testeten nun, wie sich Doxycyclin auf die Gedächtnisbildung auswirkt.
Negativ-Reaktionen abgeschwächt
Knapp 80 Personen, eingeteilt in eine Verum- und eine Kontrollgruppe, nahmen am Versuch teil. In einem Experiment erhielten die Probanden leicht schmerzhafte elektrische Reize, die sie mit einer spezifischen Farbe zu verknüpfen lernten. Die Probanden in der Verumgruppe erhielten vorher 200 mg Doxycyclin, die Probanden der Kontrollgruppe ein Placebo. Die Teilnehmer der Kontrollgruppe hatten – während sie die Farbe sahen – sieben Tage später verstärkte Schreckreaktionen. "Bei Probanden der Experimentalgruppe waren die späteren Schreckreaktionen im Vergleich zur Kontrollgruppe rund zwei Drittel schwächer", erklärt Bach. "Damit zeigen wir erstmals, dass Doxycyclin das emotionale Gedächtnis abschwächt, wenn es vor einem negativen Ereignis eingenommen wird."
Kombination mit Psychotherapie
Die Ergebnisse belegen, dass Metalloproteinasen nicht nur als Werkzeuge im Labor verwendet werden können, sondern auch beim Menschen für die Gedächtnisbildung relevant sind. Diese Enzyme liefern laut Studienautor Bach wichtige Anknüpfungspunkte, um therapeutisch wirksame Substanzen zu entwickeln. "Doch bereits mit dem heutigen Wissensstand könnte Doxycyclin wahrscheinlich angewendet werden, um vorhandene emotionale Erinnerungen zu dämpfen – wenn Patienten das wünschten", wird Bach in der Mitteilung zitiert. Für diese Behandlung würden existierende Trauma-Erinnerungen in einer Psychotherapie gezielt aktiviert und dann durch Gabe von Doxycyclin geschwächt. "Wir planen, dieses kombinierte Therapiemodell bei gesunden Menschen anzuwenden, um es dann in der Klinik zu erproben", so Bach. (eb)





