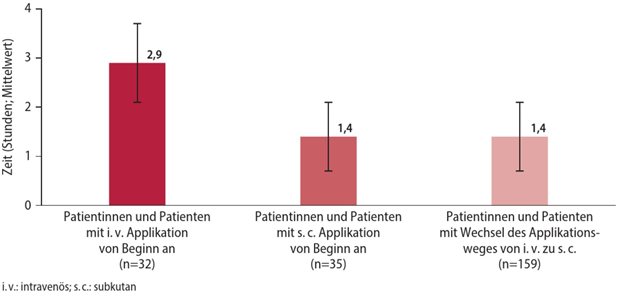EUnetHTA-Bewertung
„Antikörpertests eignen sich nicht zum Immunitätsnachweis“
Nach Ansicht europäischer Experten sind Antikörpertests zu ungenau, um nach durchgemachter COVID-19 Immunität nachweisen oder Infektiosität ausschließen zu können.
Veröffentlicht: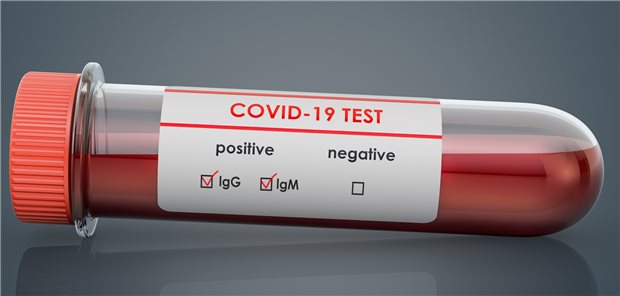
Mit Antikörpertests werden in der Regel Immunglobuline M und G erfasst.
© alexlmx / stock.adobe.com
Köln. Antikörper-Tests auf das SARS-CoV-2 sind nicht genau genug, um bei einem Menschen Immunität nachzuweisen oder Infektiosität auszuschließen. Dieses Fazit ziehen Experten in einem Bericht für das europäische Netzwerk zur Gesundheitstechnologie-Bewertung (EUnetHTA). Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat dabei die Analyse unterstützt.
Akute Infektionen werden zu spät erfasst
Mit den Tests werden in der Regel die vom Körper produzierten Antikörper (meist Immunglobuline M und G) erfasst, erinnert das IQWiG in einer Mitteilung. Eine Immunantwort ist allerdings in der Regel erst Tage nach der Infektion messbar. Die Tests schlagen daher erst stark verzögert an und sind zu langsam, um akute Infektionen nachweisen zu können. In Feldstudien lässt sich mit Antikörpertests aber der Bevölkerungsanteil mit durchgemachter Corona-Infektion erfassen (Seroprävalenz).
Nach Auswertung von weltweit 40 Studien schlussfolgern die Autoren, dass die Antikörper-Tests eine zurückliegende Infektion mit dem SARS-CoV-2 zwar nachweisen können. Es sei aber fraglich, ob ein positives Testergebnis als Zeichen einer Immunität gegen eine erneute Infektion gewertet werden könne, oder ob ein positives Testergebnis nach überstandener Infektion ein sicherer Nachweis dafür sei, dass die Person das Virus nicht mehr auf Andere übertragen kann, so das IQWiG.
Bericht soll in drei Monaten aktualisiert werden
Die Experten weisen darauf hin, dass ihre Einschätzung vorläufig ist. „Da nahezu wöchentlich neue Studienergebnisse zu erwarten sind, wird die Bewertung der Antikörper-Tests voraussichtlich in etwa drei Monaten aktualisiert“, so die Autoren.
Der EUnetHTA-Bericht soll helfen, die Corona-Diagnostik richtig einzusetzen und weiter zu entwickeln. Die aktuellen Ergebnisse haben aber keine direkten Folgen für die Frage, ob Corona-Antikörper-Tests in Deutschland von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bezahlt werden. Derzeit stehen die Tests in begründeten Einzelfällen als GKV-Leistung zur Verfügung. Ein positives Ergebnis ist meldepflichtig.
Das IQWiG ist nach eigenen Angaben seit 2006 am EUnetHTA beteiligt. Das Netz engagiert sich im Auftrag des EU-Gesundheitsdirektorats wissenschaftlich bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Bei der aktuellen Bewertung hat das IQWiG die Gesundheitsagentur der Region Emilia Romagna in Bologna unterstützt. (eis)