Blasenentzündung: die Diagnose ein Detektivstück, die Behandlung ein Versuchsfeld
Anhaltende Schmerzen in Harnblase und Becken, ohne dass Erreger nachweisbar sind - dahinter könnte das chronische Blasenschmerzsyndrom / Interstitielle Zystitis (BPS/IC) stecken. Die Therapie erfolgt individuell.
Veröffentlicht: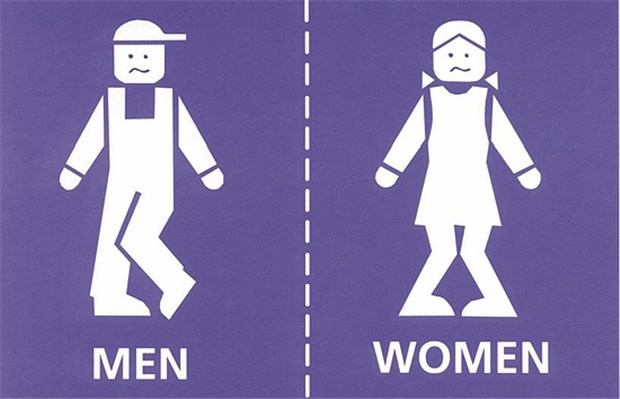
Wer schon mal eine Zystitis hatte, weiß, wie scheußlich Harndrang und "schneidendes Wasser" sind.
© Harald.Soehngen / fotolia.com
BOCHUM. BPS/IC ist eine Blasenerkrankung, die seit mindestens sechs Monaten besteht, einerseits mit Schmerz, Druckgefühl oder Unbehagen einhergeht und andererseits mit Harndrang oder erhöhter Miktionsfrequenz. Die Beschwerden schwanken in ihrer Stärke, durch Kaffee oder Zitrusfrüchte, bei Anstrengung oder Stress können sie sich verschlimmern.
Berichten Patienten über solche Symptome, gleicht die Suche nach der Ursache einer langwierigen und mühevollen Detektivarbeit, schreibt Professor Arndt van Ophoven aus Bochum in seinem CME-Beitrag (Uro-News 2010; 6: 55). BPS/IC bleibt eine strikte Ausschlussdiagnose, nachdem etwa Obstruktionen, Blasensteine, Endometriose, Karzinome, Prostatahyperplasie, Prostatitis und Infektionen (mit Chlamydien, Mycobacterium tuberculosis, Herpesviren oder Candida) abgeklärt wurden. Oft, aber nicht immer lassen sich bei BPS/IC durch kontrollierte Dehnung Glomerulationen und Risse im Urothel induzieren.
Die Ursachen sind unklar, diskutiert werden: veränderte Permeabilität der Blasenschleimhaut durch eine schadhafte Glykosaminoglykanschicht, zytotoxische Substanzen im Urin, okkulte Infektionen, autoimmune oder neuroinflammatorische Prozesse, mangelhafte Durchblutung von Beckenorganen und -muskeln.
Die Daten zur Prävalenz sind ebenfalls uneinheitlich, sie reichen von 1,1 bis 12 600 Erkrankten pro 100 000 Einwohner, darunter neunmal mehr Frauen als Männer. Das mittlere Alter liegt zwischen 42 bis 53 Jahren.
Da es kein pathogenetisch begründetes und anerkanntes Vorgehen gibt, wird vielerlei versucht, wobei die Beschwerden nur selten vollständig verschwinden. Die Ansätze umfassen orale Substanzen (etwa Analgetika, Antihistaminika, Antidepressiva), intravesikale Therapien (etwa mit Botulinumtoxin A, Heparin, DMSO oder Chondroitinsulfat), Operationen wie Harnableitung, Laser oder Resektion sowie physikalische Verfahren (etwa Blasendistension, Akupunktur oder Nervenstimulation). Auch Diät und Entspannungstechniken werden verordnet.





