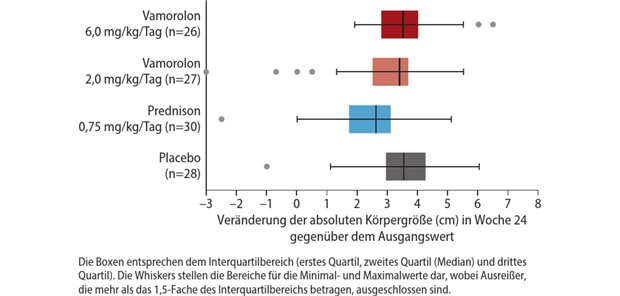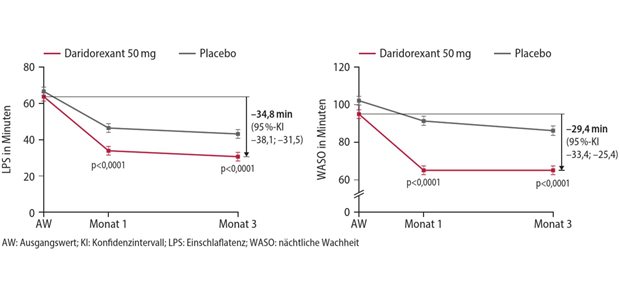Liken oder vergleichen
Mit sozialen Netzwerken in die Depression?
Je ausgiebiger sich Jugendliche auf Facebook, Instagram oder Twitter tummelten, desto höher sind die Werte auf einer Depressionsskala.
Veröffentlicht:
Viele Jugendliche geraten anscheinend durch den Vergleich auf Sozialen Netzwerken in Depressionen.
© tomass2015 / stock.adobe.com
Montreal. Zur Frage, ob bei Jugendlichen das Depressionsrisiko steigt, wenn sie viel Zeit an irgendwelchen Bildschirmen verbringen, ist die Datenlage widersprüchlich. Bisher lagen hierzu nur Querschnittstudien vor. Diese sind jedoch von der Methodik her nicht geeignet, einem möglichen kausalen Zusammenhang auf die Spur zu kommen.
Forscher haben nun erstmals untersucht, wie sich Bildschirmzeit und Depressionen bei Jugendlichen im Zeitverlauf entwickeln (JAMA Pediatr 2019; online 15. Juli). Wie die Ergebnisse der Longitudinalstudie zeigen, ist vor allem die Nutzung sozialer Medien, aber auch steigender Fernsehkonsum offenbar mit der Entwicklung oder Verstärkung depressiver Symptome im Zeitverlauf assoziiert.
Daten von knapp 4000 Schülern
Die Grundlage bilden die Daten einer randomisierten klinischen Studie mit 3826 kanadischen Schülern, in der der Erfolg eines Drogenpräventionsprogramms geprüft wurde. Die Schüler wurden von der siebten bis zur elften Klasse begleitet; bei Studienbeginn waren sie durchschnittlich knapp 13 Jahre alt.
Elroy Boers von der University of Montreal und Kollegen erfassten die Zeit, die die Teenies in sozialen Netzwerken oder mit Fernsehen oder mit Computerspielen verbrachten.
Depressive Symptome (zum Beispiel „Fühlst du dich einsam/traurig/hoffnungslos?“) wurden mit der Depressionsskala des Brief Symptoms Inventory erfasst (auf der 28-Punkte-Skala entsprechen höhere Werte schwereren Symptomen).
Überraschende Ergebnisse in puncto Gaming
Am frappierendsten war der Zusammenhang bei den sozialen Netzwerken: Je ausgiebiger sich die Teilnehmer im vierjährigen Beobachtungszeitraum auf Facebook, Instagram oder Twitter tummelten, desto höher waren die Werte auf der Depressionsskala (pro Stunde um 0,64 Punkte).
Ein anderes Studienergebnis: Für jede Stunde, die ein Teilnehmer innerhalb eines bestimmten Jahres über den persönlichen Durchschnitt hinaus in sozialen Netzen verbrachte, wurde ein (signifikanter) Anstieg um 0,41 Punkte dokumentiert.
Was zunächst überrascht: Selbst ausgiebiges Gaming (Video- bzw. Computerspiele) war offenbar nicht mit der Entwicklung von Depressionen verknüpft.
Beim Fernsehen waren die Ergebnisse widersprüchlich: Jugendliche, die in den vier Studienjahren insgesamt viel in die Röhre guckten, zeigten eher geringer ausgeprägte Symptome (–0,22 Punkte pro zusätzliche Stunde). Andererseits war jede Stunde, um die der Fernsehkonsum beim Einzelnen innerhalb eines Jahres zunahm, mit einem Anstieg um 0,18 Punkte auf der Depressionsskala verbunden.
Den Jugendlichen werden „idealisierte Bilder“ vorgeführt
Die Erklärung der Forscher: In den sozialen Netzwerken und zum Teil auch im Fernsehen werden den Jugendlichen „idealisierte Bilder“ vorgeführt. Der ständige „Aufwärtsvergleich“ so die Forscher, sei bei Jugendlichen möglicherweise ein Trigger oder ein Verstärker für Depressionen.
Beim Computerspielen besteht zwar eine nicht zu unterschätzende Suchtgefahr. So ist die „Gaming disorder“ von der WHO mittlerweile als psychische Störung anerkannt. Laut dem Team um Boers gibt es jedoch auch Studien, die belegen, dass das Gaming im Freundeskreis positive Auswirkungen haben könne, sowohl sozial als auch emotional: „Gamer sind heutzutage, anders als noch vor etwa 15 oder 20 Jahren, nicht sozial isoliert“.
Die Mehrzahl, nämlich rund 70 Prozent, spiele mit Freunden, auch wenn sie diesen oft nur im virtuellen Raum begegnen. Das Gaming zähle heute sogar „zu den wirksamsten Mitteln, mit denen Jugendliche positive Gefühle generieren“.
Hypothese der negativen Auswirkungen des sozialen Vergleichs „nach oben“
Den Forschern zufolge stützen die Ergebnisse insgesamt die Hypothese von den negativen Auswirkungen des sozialen Vergleichs „nach oben“. Wie eine Post-hoc-Analyse ergab, sank beim einzelnen Teilnehmer mit jeder zusätzlichen Stunde, die innerhalb eines Jahres mit Facebook, Twitter oder Instagram draufging, das Selbstwertgefühl (gemessen mithilfe der Rosenberg-Self-Esteem-Scale).
Ähnlich verhielt es sich beim Fernsehen. Auch hier war die individuelle Zunahme der Bildschirmzeit im Zeitverlauf mit einem signifikanten Absacken der Selbstachtung verknüpft – laut Boers und Kollegen möglicherweise ebenfalls aufgrund des erwähnten „Aufwärtsvergleichs“, etwa beim Sehen von Casting-Shows.
Ein Spezifikum vor allem der sozialen Medien sei, dass diese – im Gegensatz zum Gaming – die negative Stimmung des Nutzers verstärkten, und zwar umso mehr, je ausgiebiger sie genutzt würden. Dies hänge möglicherweise auch mit der Auswahl der Informationen durch den User zusammen („je schlechter die Stimmung, desto weniger positive Inhalte werden ausgewählt“). Damit werde die depressive Stimmung nicht nur aufrechterhalten, sondern sogar noch verstärkt.
Die Wissenschaftler fordern auf dieser Grundlage, die Nutzung sozialer Netzwerke, aber auch den Fernsehkonsum stärker zu reglementieren. Damit könne man dazu beitragen, Depressionen bei Jugendlichen vorzubeugen oder eine Verschlechterung bestehender Symptome zu verhindern.