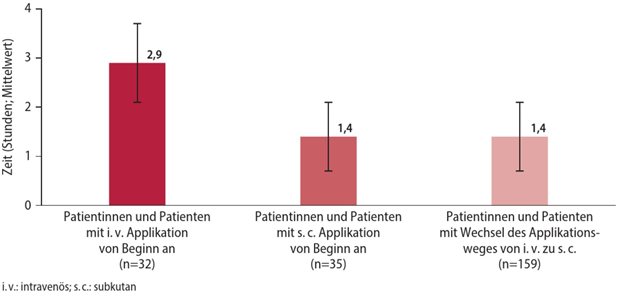Corona-Modellrechnung
Omikron-Welle läuft wohl auf Höhepunkt zu
Berechnungen des RKI und der Berliner Humboldt-Universität gehen für die kommnenden Wochen von 300.000 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 pro Tag aus. Ab Mitte Februar könnte die Welle brechen.
Veröffentlicht:
Das RKI rechnet mit weiter stark steigenden Infektionen in den kommenden Wochen.
© Photocreo Bednarek / stock.adobe.com
Berlin. 400.000 Infektionen mit der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 am Tag. Diese Zahl hat Gesundheitsminister Professor Karl Lauterbach (SPD) in den vergangenen Tagen mehrfach in den Raum gestellt. Bis Mitte Februar sei mit massiv steigenden Infektionszahlen zu rechnen. Erst danach könne die Omikron-Welle wieder abflachen.
Das Robert Koch-Institut hat nun Ergebnisse einer Modellrechnung veröffentlicht, die Lauterbachs Einschätzung stützen. Ziel der gemeinsamen Arbeit der Rechenlabore von RKI sowie des Instituts für Theoretische Biologie und Integrated Research Institute for the Life Sciences der Berliner Humboldt-Universität waren „Größenordnungsabschätzungen der Kerngrößen des Infektionsgeschehens“. Kalibriert wurde das Modell bis zum 1. Januar.
Meldelogistik beschränkt echte Statistik
Demnach sind in der näheren Zukunft im Median 300.000 Neuinfektionen am Tag zu erwarten, bei Schwankungen von zwischen 180.000 und 450.000 Neuinfektionen am Tag. Bis zum 1. April könne die Zahl der insgesamt gemeldeten Omikronfälle mehr als 16 Millionen betragen. Die Autoren weisen darauf hin, dass die Zahl der tatsächlich gemeldeten Fälle systematisch darunter liegen dürfte. Dies sei auf die Beschränkungen der Meldelogistik und die Testpriorisierung zurückzuführen.
Sie schätzen, dass das relative Risiko, mit Omikron auf einer Intensivstation behandelt werden zu müssen, zehn bis 20 Prozent des Risikos der mit der Delta-Variante infizierten annehmen müsse, um eine Überlastung der Stationen zu verhindern. Ihre Berechnungen zeigen, dass zum Beispiel 15 Millionen zusätzliche Erstimmunisierungen das Risiko maximal belasteter Intensivstationen stark verringern könnten.
Leichte Kontaktbeschränkungen schwächen den Ausbruch
Die Wissenschaftler haben auch die Einflüsse von Kontaktbeschränkungen, Auffrischungsimpfungen sowie unterschiedlicher Latenzzeiten modelliert. Dabei zeigte sich, dass eine leichte Verringerung von Kontakten wie sie die Menschen zum Beispiel von sich aus herbeiführen, „substantielle Reduktionen in der Ausbruchsgröße“ auslösen.
Eine Verringerung der Kontakte um 20 Prozent bis zum 15. Februar könne einen „brechenden Effekt“ auf die Welle ausüben. Harte Lockdowns zu Beginn der Omikron-Welle hätten aber wohl zu einem starken „Rebound-Effekt“ mit höheren Ausbruchsgrößen geführt. Grund: Die Wirkung der Auffrischungsimpfungen wäre dann bereits abgeschwächt gewesen. (af)