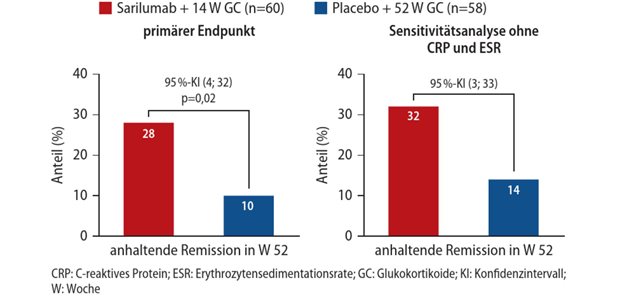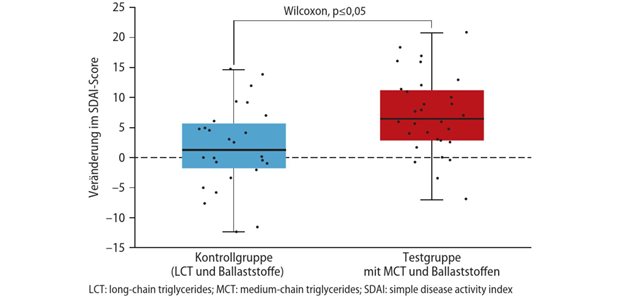Beinprothesen
Wie Tastsensoren bei Prothesen für sicheren Gang und Akzeptanz sorgen
Werden Beinprothesen per im Oberschenkel implantierter Elektroden mit dem Nervensystem verbunden, verringert das das empfundene Gewicht der Prothese, führt zu einem sicheren Gang und erhöht die Akzeptanz der künstlichen Gliedmaße, haben Schweizer Forscher herausgefunden.
Veröffentlicht:
Prothese mit Tastsensoren an der Sohle: Die Informationen der Sensoren können über implantierte Elektroden direkt an das Nervensystem des Trägers weitergegeben werden.
© ETH Zürich
Zürich. Beinamputierte Personen nehmen ihre Prothese eher als Teil ihres Körpers wahr, wenn sensorische Signale der Prothese an das Nervensystem weitergeleitet werden. Dies führt auch dazu, die Prothesen als leichter zu empfinden, haben Forscher der Technischen Hochschule Zürich herausgefunden. Denn obwohl eine Beinprothese in der Regel weniger als halb so schwer ist wie eine natürliche Gliedmaße, empfinden die Träger das Gewicht der Prothese häufig als zu hoch, teilt die Hochschule mit.
Die Verbindung der Prothesen mit dem Nervensystem gelingt über in den Oberschenkel implantierte Elektroden, welche mit den dort vorhandenen Beinnerven verbunden werden. So können die Prothesen dem Nervensystem des Trägers ein Feedback geben. Informationen von Tastsensoren unter der Fußsohle sowie von Winkelsensoren im elektronischen Prothesen-Kniegelenk werden dazu in Stromimpulse umgewandelt und an die Nerven weitergegeben, heißt es in der Mitteilung.
Prothese ein Viertel leichter
„Wir stellten das verlorene sensorische Feedback künstlich wieder her. Dem Gehirn einer oberschenkelamputierten Person wird so vorgegaukelt, dass die Beinprothese ihrem eigenen Bein ähnlich ist“, wird Professor Stanisa Raspopovic in der Mitteilung zitiert. Raspopovic leitet das Projekt an der Hochschule. In einer im letzten Jahr veröffentlichten Studie demonstrierte er mit seinem Team, dass sich Träger solcher Neurofeedback-Prothesen sicherer und mit weniger Kraftanstrengung fortbewegen können.
In einer weiteren Studie kamen die Wissenschaftler nun zu dem Ergebnis, dass das Neurofeedback für die Prothesenträger auch das empfundene Gewicht der Prothese um 23 Prozent oder knapp 500 Gramm reduziert, was der Akzeptanz der Prothese zuträglich ist (Curr Biol 2021; online 7. Januar). Für diese Untersuchung ließen die Forscher oberschenkelamputierte Personen Gangübungen mit entweder eingeschaltetem oder ausgeschaltetem Neurofeedback absolvieren. Dabei beschwerten sie den gesunden Fuß mit Zusatzgewichten und ließen die Studienteilnehmer bewerten, als wie schwer diese die beiden Beine im Verhältnis zueinander empfinden.
Dass sich das Neurofeedback positiv auf das Gehirn auswirkt, bestätigten die Wissenschaftler außerdem mit einer motorisch-kognitiven Aufgabe, bei der ein Proband beim Gehen Wörter mit fünf Buchstaben rückwärts buchstabieren sollte. Das sensorische Feedback ermöglichte ihm nicht nur einen schnelleren Gang, sondern er schnitt auch bei der Buchstabierübung besser ab. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich damit ganz grundsätzlich die Erfahrung von Patienten mit künstlichen Gliedmaßen näher an jene mit einer natürlichen Gliedmaße heranführen lässt“, wird Raspopovic in der Mitteilung zitiert. (eb)