Europäischer Gesundheitskongress
Apotheke der Welt? Ein dorniger Weg für Deutschland
Deutschland und Europa brauchen eine „stimulierende Standortpolitik“, um im Wettbewerb mit China und den USA bestehen zu können. Digitalisierung und der Zugang auch der Industrie zu Gesundheitsdaten werden dabei mitentscheidend sein.
Veröffentlicht: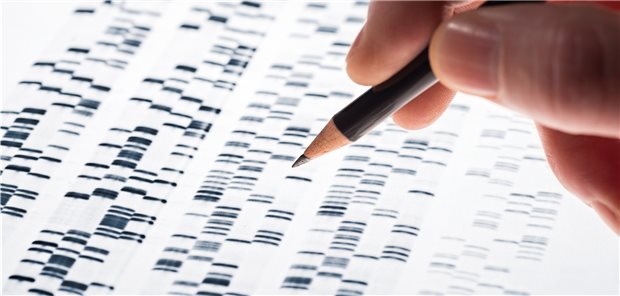
Auswertung eines DNA-Gels: Für die forschende Pharmaindustrie steht der Zugang zu pseudonymisierten Gesundheitsdaten mit oben auf der Agenda.
© gopixa / Getty Images / iStock
München. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung, Nano-, Bio- und Gentechnologie werden die Treiber für Innovationen in der pharmazeutischen Industrie sein. Deutschland und Europa werden in naher Zukunft erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um im Wettbewerb mit den USA und China bestehen zu können und um wieder Eigenständigkeit bei der Versorgung mit Rohstoffen zurückzugewinnen.
Das war einhellige Auffassung von Vertretern aus der pharmazeutischen Industrie und der Wissenschaft bei einem Symposion des Europäischen Gesundheitskongresses am Donnerstag in München (EGKM).
Die Bestandsaufnahme, so Dr. Rainer Wessel, Chief Innovation Officer des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg, fällt hinsichtlich der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der forschenden Pharmaindustrie in Deutschland und Europa kritisch aus: Es gebe eine „strategische Abhängigkeit“ bei der Versorgung mit Arzneimitteln von Drittstaaten, insbesondere China.
Konzertierte Aktion der Politik nötig
Erkenntnisse aus der durchaus führenden Grundlagenforschung werden im Vergleich zu den USA in der Versorgung zu wenig genutzt; Bürokratie, regulatorische Hürden sowie Mangel an Risikokapital und Risikobereitschaft seien wesentliche Faktoren für die schleppende Entwicklung und Einführung von Innovationen.
Notwendig, so Wessel, sei eine konzertierte Aktion der Politik mit der akademischen und industriellen Forschung, um regulatorische Hürden abzubauen, den Zugang der Industrieforschung zu Gesundheitsdaten zu ermöglichen und höhere Investitionen in neue Gesundheitsanwendungen zu anzureizen.
Deutschland und Europa bräuchten nun eine „stimulierende Standortpolitik“, forderte Dr. Sabine Nikolaus, Deutschland-Chefin von Boehringer Ingelheim und Vizepräsidentin des Verbandes der forschenden Pharma-Unternehmen. Die konkreten Anforderungen:
Globales Denken: Freier Waren- und Dienstleistungsverkehr, internationale Diversität und internationale Rekrutierung der Mitarbeiter-Teams;
Fokussierung auf die Biotechnologie, die derzeit rund 30 Prozent der Wertschöpfung ausmacht – mit steigender Tendenz. Bei stagnierender Zahl der Neugründungen falle Deutschland mit seiner Biotech-Produktionskapazität inzwischen weltweit auf Platz 3 zurück – dringend notwendig sei die Gewinnung von Wagniskapital;
Zugang der industriellen Forschung zu pseudonymisierten Gesundheitsdaten: Gegenwärtig haben nur öffentliche Forschungseinrichtungen das Recht, anonymisierte Daten aus Registern und der Routinedaten der Krankenkassen zu nutzen. Die perspektivisch mit einer elektronischen Gesundheitsakte zu gewinnenden Daten könnten pseudonymisiert einen erheblichen Mehrwert in der Industrieforschung bei der Stratifizierung und Personalisierung der Medizin und der Bemessung des Zusatznutzens von Innovationen generieren, so Nikolaus. Israel habe bei seiner COVID-Impfstrategie gezeigt, wie in einem voll digitalisierten Gesundheitswesen klinische Daten auch durch Zugang der Industrie für die Gesellschaft genutzt werden können.
Beschleunigung der Genehmigungsprozesse für klinische Forschung, etwa bei der Genehmigung von Studien durch Ethikkommissionen – etwa nach dem Vorbild von Sonderregelungen für COVID-Therapeutika.
Mehr „strategische Autonomie“ in Europa
Nach Auffassung der Europa-Ministerin in der bayerischen Staatskanzlei, Melanie Huml (CSU), hat die COVID-Pandemie die Schwächen, aber auch die Chancen der Gesundheitssysteme in Europa offenbart: Das seien einerseits die fragilen Lieferketten, weswegen sich Europa um eine „strategische Autonomie“ bemühen müsse. Gemeint damit sei die Verhinderung von internationalen Monopolen.
Andererseits habe die Pandemie auch als Katalysator bei der Beschleunigung von Forschungs- und regulatorischen Prozessen gewirkt – Erfahrungen, die lehrreich für den „Regelbetrieb“ sein könnten.
Forschungs- und Entwicklungskosten werden weiter steigen
Der Heidelberger Gesundheitsökonom Professor Michael Schlander sieht die Kostenentwicklung in der Industrie als Herausforderung: Nach seinen Analysen wird es zwar gelingen, die Produktionskosten für innovative hochkomplexe Therapien durch industrielle Reorganisation und Skaleneffekte signifikant zu senken, das Problem steigender Forschungs- und Entwicklungskosten (FuE) bleibe aber bestehen.
Im teuersten Segment, der ZNS-Forschung, erreichten die Entwicklungskosten bereits 1,5 bis 2 Milliarden Euro. Dies führe dazu, dass sich eine Refinanzierung nach der Logik mancher europäischer Erstattungssysteme – wie etwa in Großbritannien – nicht mehr abbilden lasse. Eine Harmonisierung der europäischen Systeme zur Nutzenbewertung (HTA) sieht er daher eher kritisch.















