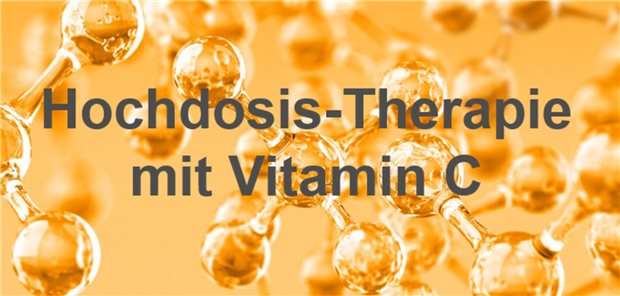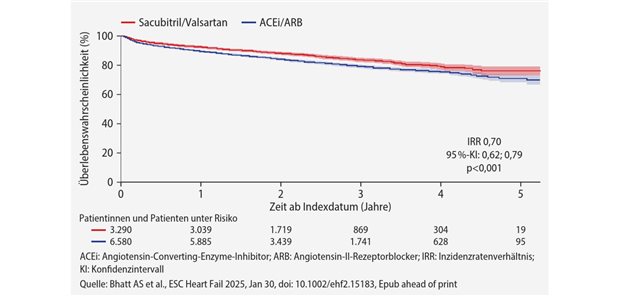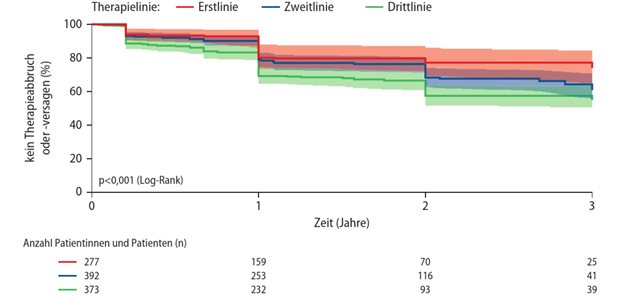Intensivpflege und Reha
Betreuung auch außerhalb von Heimen möglich
Nach heftigen Protesten soll die Intensivpflege etwa von Beatmungspatienten auch künftig zu Hause oder in Wohngruppen gestattet sein. Aber die Überprüfung dieser Einrichtungen soll verschärft werden.
Veröffentlicht:
Das Bundesgesundheitsministerium hat den Vorrang für die stationäre Intensivpflege aus seinem Gesetzentwurf gekippt. Doch die Pflegeeinrichtungen müssen sich auf schärfere Überprüfungen einstellen.
© blauviolette / stock.adobe.com
Berlin. Nach langen Diskussionen hat das Bundeskabinett am Mittwoch den Entwurf für das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungs-Gesetz (IPReG) beschlossen. Seine Vorlage im Kabinett war mehrfach verschoben worden. Der Referentenentwurf vom August vergangenen Jahres war teils auf massiven Widerstand gestoßen.
Ursprünglich wollte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass die außerklinische Intensivpflege regelhaft in vollstationären Pflegeeinrichtungen stattfindet. Nur noch in Ausnahmefällen sollte die Pflege beispielsweise von dauerhaft beatmeten Patienten in der eigenen Häuslichkeit erlaubt sein. Dieser Eingriff in die freie Wohnortwahl ist in der Kabinettsfassung deutlich abgemildert worden.
Jährliche Prüfung vor Ort
Nun kann die außerklinische Intensivpflege auch in Pflegeeinrichtungen, „qualitätsgesicherten Intensiv-Wohneinheiten“ oder in der eigenen Wohnung gewährleistet werden. Dem Gemeinsamen Bundesausschuss wird aufgegeben, einheitliche Vorgaben für die Qualität der Pflegedienste zu formulieren. Zudem sollen die Kassen jährlich den Medizinischen Dienst mit der Prüfung vor Ort beauftragen, ob dort die medizinische und pflegerische Versorgung sichergestellt werden kann.Der ursprüngliche Vorrang für die stationäre Pflege war auf vielfältigen Widerstand getroffen. So fürchtete etwa die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, durch die Nutzung von Heimpflegeplätzen für die Intensivpflege könnten die Kapazitäten noch knapper werden.
Die Vertretung der Kommunen und Städte lenkte den Blick indes auf Defizite in den bisherigen Versorgungsstrukturen. So stehe vielerorts „keine strukturierte ambulante ärztliche Betreuung zur Verfügung“. Regelmäßige Hausbesuche durch qualifizierte Ärzte erfolgten dann nicht. Insgesamt mangele es an einer Vernetzung der ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen sowie an einem Case-Management, hieß es anlässlich der Anhörung des Referentenentwurfs.
Raum für ökonomische Anreize
Vor diesem Hintergrund erhielt der Entwurf etwa vom AOK-Bundesverband viel Lob. Die bisherige Versorgung entspreche vielfach nicht verlässlichen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen und gebe „marktförmig-ökonomischen Anreizen“ großen Raum. Konkret beklagt der Kassenverband, es gebe Hinweise, dass Patienten in „signifikanter Höhe“ in die außerklinische Langzeitpflege verschoben werden, obwohl gar keine Indikation für ein Tracheostoma oder eine invasive außerklinische Beatmung besteht.Die Deutsche Krankenhausgesellschaft beklagte in ihrer Kommentierung des ersten Aufschlags aus dem BMG, die vielfältigen Gründe für eine außerklinische Beatmung würden in dem Entwurf nicht ausreichend adressiert. Häufige Krankheitsbilder seien komplexe Missbildungen und zentrale Atemregulationsstörungen, neuromuskuläre Erkrankungen oder Patienten mit hypoxischen Hirnschäden, etwa nach überlebter Reanimation. Im Ergebnis werde ein Großteil der außerklinisch beatmeten Patienten nicht wegen eines pulmonalen Problems, sondern wegen anderer Grunderkrankungen beatmet.
Auch die Datengrundlage, wie viele Patienten tatsächlich betroffen sind, blieb vage. Die KBV geht von rund 15 .000 invasiv beatmeten Patienten aus, in der Gesetzesbegründung war ursprünglich aber von „bis zu 50 .000 Leistungsfällen“ die Rede.
Kernpunkte des Gesetzentwurfs
Der Kabinettsentwurf umfasst folgende zentralen Regelungen:- Geschaffen wird ein neuer Leistungsanspruch auf außerklinische Intensivpflege im SGB V. Die Verordnung darf nur durch „besonders qualifizierte Ärzte“ erfolgen – welche Qualifikationen das im einzelnen sind, soll der GBA festlegen. Als im besonderen Maße qualifiziert angesehen werden Fachärzte für Innere Medizin und Pneumologie, für Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Pneumologie sowie Fachärzte für Anästhesie, für Neurologie oder Fachärzte mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin.
- Wird ein Intensiv-Pflegebedürftiger in einem stationären Heim untergebracht, soll er dort „weitgehend von Eigenanteilen entlastet werden“. Die Belastungen dürfen „nicht erheblich höher sein als in der ambulanten Versorgung“, heißt es in der Gesetzesbegründung. Vor der Entlassung aus dem Krankenhaus muss der Beatmungspatient dahingehend untersucht werden, ob eine Entwöhnung möglich ist. Wenn nötig müssen Kliniken dafür externe ärztliche Expertise heranziehen. Unterbleibt dieser Versuch, drohen den Krankenhäusern Vergütungsabschläge, die einen „hinreichenden Anreiz“ darstellen sollen, das Potenzial der Beatmungsentwöhnung auszuloten. Das soll einen „voreiligen“ Transfer der Patienten in die ambulante Intensivpflege verhindern.
- Verordnen Ärzte eine geriatrische Rehabilitation, dann sind Kassen künftig an diese Entscheidung gebunden. Dabei gilt, dass die Ergebnisse geriatrischer Assessments nicht allein eine Reha-Indikation begründen können. Der verordnende Arzt muss Reha-Bedürftigkeit, -fähigkeit und die Reha-Prognose begründen. Die Dauer der geriatrischen Reha wird auf 20 Tage (ambulant) oder drei Wochen (stationär) festgelegt. Erstmalig Mitte 2022 soll der GKV-Spitzenverband dem Bundestag über die Erfahrungen mit der Verordnung von geriatrischer Reha berichten.
- Das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten wird dadurch gestärkt, dass der Mehrkostenanteil für den Fall halbiert wird, dass sie sich für eine andere Einrichtung entscheiden, als ihnen von der Kasse zugewiesen wurde.
- Reha-Einrichtungen haben zuletzt unter wachsenden Problemen gelitten, qualifiziertes Personal zu gewinnen. Der Gesetzentwurf bohrt daher den Grundsatz der Beitragsstabilität für Leistungen zur medizinischen Vorsorge und Reha auf. Konkret können Reha-Träger und Kassen dadurch Vergütungen vereinbaren, die über die jährliche Grundlohnsummensteigerung hinausgehen. „Durch höhere Vergütungen können Einrichtungen in die Lage versetzt werden, Mehrausgaben zu finanzieren, die etwa durch Tariferhöhungen bei den Gehältern der Mitarbeiter entstehen“, heißt es.
Das Gesetz soll nach der parlamentarischen Beratung voraussichtlich im Sommer in Kraft treten. Eine Zustimmung des Bundesrats ist nicht erforderlich.