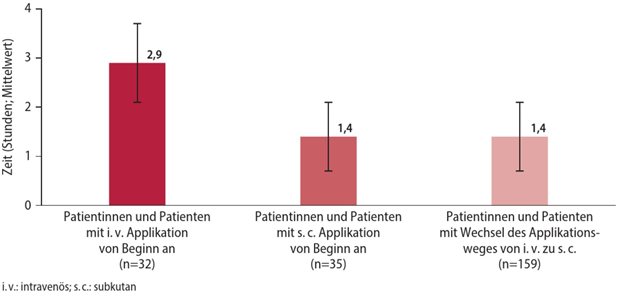Pandemie und Familie
Kinderkrankengeld: Regierung tappt nahezu im Dunkeln
Die Regelungen zur Zahlung von Kinderkrankengeld wurden in der Pandemie mehrfach angepasst. Wie die Leistungen in Anspruch genommen wurden, darüber weiß die Regierung allerdings nur wenig.
Veröffentlicht:
Kinder in Quarantäne oder Kita zu: Auch für solche Fälle ist die temporäre Regelung zum Kinderkrankengeld in diesem Jahr gedacht.
© famveldman / stock.adobe.com
Berlin. Die Ausgaben für das Kinderkrankengeld lagen im Pandemiejahr 2020 deutlich unter dem Vorkrisenjahr 2019. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion hervor.
Zahlten die Gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2019 insgesamt 272 Millionen Euro an Eltern aus, die das Kinderkrankengeld in Anspruch genommen haben, waren es im vergangenen Jahr 30 Millionen Euro weniger. Das könnte mit dem starken Anstieg der Homeoffice-Tätigkeiten zusammenhängen. Allerdings deutet sich an, dass in diesem Jahr die Ausgaben für das Kinderkrankengeld höher ausfallen werden. So wurden bereits im ersten Quartal des laufenden Jahres 146,6 Millionen Euro ausgezahlt. Das sind 46 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und 59 Prozent mehr als im Vorpandemiejahr 2019.
Bis zu 130 Tage theoretisch möglich
Der Anspruch auf Kinderkrankengeld war wegen der Pandemie mehrmals temporär ausgeweitet worden. So können gesetzlich Versicherte normalerweise für jedes Kind, welches das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Kinderkrankengeld für zehn Arbeitstage im Kalenderjahr beziehen, Alleinerziehende 20 Tage. Insgesamt ist der Anspruch auf 25 Tage beziehungsweise 50 Tage pro Kalenderjahr begrenzt.
Im September vergangenen Jahres war der Anspruch bereits auf 15 Tage pro Elternteil und 30 Tage für Alleinerziehende ausgeweitet worden. Im Januar dieses Jahres dann sogar auf 30 beziehungsweise 60 Tage. Bei mehreren Kindern auf höchstens 65 beziehungsweise 130. Der Anspruch besteht in diesem Jahr nun nicht mehr nur bei tatsächlicher Erkrankung des Kindes, sondern auch, wenn die Betreuungseinrichtung durch Anordnung einer Behörde geschlossen oder von einem Besuch abgeraten wird. Das könnte den Anstieg der Ausgaben im ersten Quartal erklären.
Bund beteiligt sich an versicherungsfremder Leistung
Damit die Ausgaben für diese versicherungsfremden Leistungen kompensiert werden, hat der Bund dem Gesundheitsfonds im ersten Quartal dieses Jahres 300 Millionen Euro überwiesen.
In ihrer Anfrage wollte die FDP-Fraktion wissen, welche Erkenntnisse die Bundesregierung über die Inanspruchnahme der Leistungen hat und ob die Regelungen den Bedürfnissen der Familien gerecht werden. Sie fragte zum Beispiel danach, wie viele Anträge wegen der Erkrankung eines Kindes gestellt worden seien und wie viele wegen behördlicher Schließungen oder der Empfehlung, auf den Besuch einer Betreuungeinrichtung zu verzichten. Oder auch, wie viele Anträge abgelehnt worden seien und aus welchen Gründen?
Die Antwort fiel für die Fraktion ernüchternd aus, denn die Regierung hat – außer zu den GKV-Ausgaben – kaum Erkenntnisse zu diesem Themenkomplex und verweist bei vielen Fragen auf die Zuständigkeit der Länder. Lediglich auf die Frage, ob sie die derzeit geltenden Regelungen für ausreichend hält, antwortet der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Dr. Thomas Gebhart: „Die Bundesregierung hält die Regelungen zum Kinderkrankengeld für ausgewogen und angemessen. Änderungen sind derzeit nicht geplant.“
„Ignorant“, rügt die Abgeordnete Helling-Plahr
„Dass die Koalition bei ihrer Politik offenbar völlig auf Sicht gefahren ist, ohne sich irgendeinen Überblick über die tatsächliche Situation in den Familien zu verschaffen, macht sprachlos“, kommentiert die FDP-Bundestagsabgeordnete Katrin Helling-Plahr die Antwort der Regierung. Die Koalition agiere völlig an der Lebenswelt vorbei, kritisiert sie. Die Regierung wisse weder, wie viele Anträge auf Kinderkrankengeld gestellt oder bewilligt, noch wie viele Eltern bereits die maximale Zahl an Krankentagen aufgebraucht hätten. Auf der anderen Seite sei sie aber sicher, dass die bestehenden Regelungen angemessen und ausgewogen seien.
„Sich nicht einmal zu mühen Fakten über die tatsächliche Belastung der Familien zu verschaffen, ist ignorant“, rügt Helling-Plahr. Kinder und Familien dürften von der Bundesregierung spätestens im zweiten Pandemiejahr vorausschauende Politik und individuelle Planbarkeit erwarten. (chb)