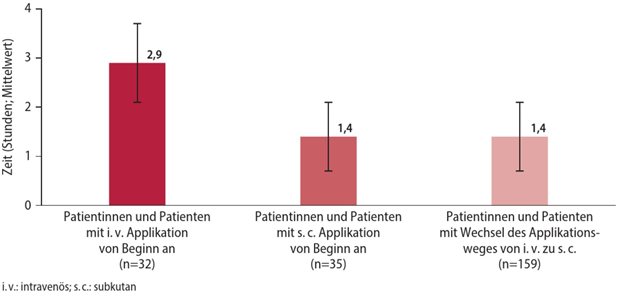Diskussionspapier
Lockerung und Lockdown: Zi will Teufelskreis der Corona-Pandemie durchbrechen
Wie lässt sich eine ständige Abfolge von Lockdowns und Lockerungen in der Corona-Pandemie verhindern? Das Zentralinstitut der KVen schlägt für Engpässe eine Konzentration der COVID-Prävention auf 40 Prozent der Bevölkerung vor.
Veröffentlicht:
Eine Altenpflegerin führt in einem Seniorenheim in Tübingen Antigen-Corona-Schnelltests bei Bewohnern durch. Solche vulnerablen Gruppen sollten laut Zi in der COVID-Prävention stärker Vorrang haben.
© Sebastian Gollnow/dpa
Berlin. Die aktuell hohe Zahl an Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland hängt auch damit zusammen, dass die Gesundheitsämter die Kontakte von Infizierten nicht mehr nachverfolgen und isolieren können. Deshalb sollten nun ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen besonders geschützt werden, so wie es der Nationale Pandemieplan vorsehe. Darauf verweist das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung (Zi) in einem am Freitag veröffentlichten Diskussionsbeitrag. Allgemeine Kontaktbeschränkungen seien dagegen eher zu unspezifisch.
Die Autoren schlagen in dem Beitrag daher eine Rückbesinnung auf die Ziele des Nationalen Pandemieplans vor. Kein unmittelbares Ziel des Plans sei es, die Infektionszahlen so gering wie möglich zu halten. Vielmehr sollten vor allem schwere Verläufe von Infektionen verringert werden. Dafür sollten sich Schutzmaßnahmen besonders auf die rund 23 Millionen über 60-Jährigen ausrichten, immerhin 28 Prozent der Gesamtbevölkerung. „Die ältere Bevölkerungsgruppe in Deutschland ist durch eine SARS-CoV-2-Infektion besonders anfällig für Morbidität und Mortalität“, heißt es in dem ZI-Papier.
Schwerere Verläufe im Alter
Auf der Grundlage von Abrechnungsdaten rechnet das Zi 31 Millionen Menschen in Deutschland, mithin 40 Prozent der Bevölkerung, dem vulnerablen Personenkreis mit erhöhtem Risiko für einen schwereren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung zu. In dieser Zahl sind zusätzlich die Menschen mit Vorerkrankungen eingeschlossen.
Ablesen lässt sich das auch an den Todesraten der Alterskohorten. Die geschätzten altersspezifischen Todesraten nach Infektionen für Kinder und junge Erwachsene fielen sehr niedrig aus und lägen ab einem Alter von 55 Jahren bei 0,4 Prozent, ab 65 Jahren bei 1,3 Prozent, ab 75 Jahren bei 4,3 Prozent und ab 85 Jahren bei 14 Prozent, zitieren die Zi-Autoren eine aktuelle Meta-Analyse des Infektionsgeschehens. Gleichzeitig zeigten sich in den vulnerablen Gruppen auch verstärkt die Langzeitfolgen der Erkrankung.
Kontaktverfolgung staffeln
Das Zi geht davon aus, dass das Ziel, möglichst alle COVID-19-Fälle zu registrieren, bereits zugunsten einer Konzentration auf schwere Verläufe, Risikogruppen und Clusterbildung aufgegeben worden sei. Dies schließen sie aus den Anpassungen der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts vom 3. November. Dort heißt es, dass aufgrund knapper PCR-Testkapazitäten Personen mit nur leichten Erkältungen nicht mehr getestet werden sollen.
„EvidenzUpdate“-Podcast
Hammer, Welle, Lockdown – wissen wir, was wir tun?
Deshalb sieht das Institut die Voraussetzungen auch für einen Präventionsansatz gegeben, der die Ressourcen auf die vulnerablen Gruppen konzentriert. Konkret würde das bedeuten, dass unverändert breit in allen Altersgruppen getestet, die Kontaktverfolgung bei positiv getesteten Personen aber nach Relevanz gestaffelt werden würde, wenn die Anzahl der zu verfolgenden Kontakte relativ zu den dafür verfügbaren Ressourcen zunähme. Verfolgt würden dann eher Kontakte, die ihrerseits wiederum in Beziehung zu Risikogruppen stehen, also zum Beispiel Menschen in Gesundheitsberufen.
Entscheidungshilfe für den ÖGD
Die Gesundheitsämter bräuchten dafür eine Entscheidungsmatrix, anhand derer sie zwischen dem Voll- und einem Teilverfolgungsmodus wechseln könnten. Eine Marke für den Strategie-Switch sehen die Zi-Autoren in einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen, bezogen alleine auf die Gruppe der über 60-Jährigen.
Sie betonen, dass ihre Vorschläge als Ergänzung zur Nationalen Teststrategie und den allgemeinen Hygienekonzepten gedacht seien, gleichwohl aber auch dazu beitragen könnten, eine Kette von aufeinanderfolgenden „Lockdowns“ und die daraus folgenden gesellschaftlichen Kosten zu vermeiden. Der Beitrag korrespondiert mit einem Vorstoß der Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, zu der das Zi gehört, und der Virologen Professor Hendrik Streeck (Universität Bonn) und Professor Jonas Schmidt-Chanasit (Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, Hamburg) von Ende Oktober. Der hatte zu einer Kontroverse in der Ärzteschaft geführt.
News per Messenger
Neu: WhatsApp-Kanal der Ärzte Zeitung
So hoch ist die Corona-Inzidenz in den einzelnen Städten und Landkreisen
Lockdown – „Unsere psychische Widerstandskraft wird geschwächt“