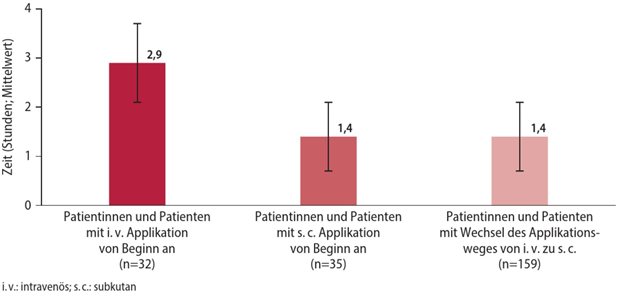Folgen von COVID-19
Mehr Staat – ein Rezept für bessere Gesundheitspolitik?
Deutschland hat die Pandemie nicht schlecht gemeistert. Trotzdem werden Rufe laut, mehr Staatsnähe tue dem Gesundheitssystem gut. Was taugt diese Forderung?
Veröffentlicht:
Deutschland abgehört: Geben die bisherigen Erfahrungen mit der Pandemie Anlass, das Gesundheitswesen staatsnäher zu organisieren?
© alexlmx / stock.adobe.com
Berlin. „Mehr Staat“ – das ist eine in den vergangenen Wochen häufig geäußerte Forderung: Die Coronavirus-Pandemie, so diese Lesart, habe die Bedeutung der staatlichen Daseinsvorsorge allen vor Augen geführt. Die stark von der Exekutive geprägte – vergleichsweise erfolgreiche – Krisenbewältigung verleitet dann zur Annahme, dass dies auch in normalen Zeiten als ein Steuerungsmodell für das Gesundheitssystem taugt.
Dr. Jochen Pimpertz, Gesundheitsökonom am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW), hat daran große Zweifel. In einem Thesenpapier bezeichnet er den Ruf nach mehr Staat als „Systemdebatte zur Unzeit“. Denn seiner Ansicht ist die „glimpfliche Corona-Bilanz auch ein Erfolg privatwirtschaftlicher Strukturen im Gesundheitssystem“.
Reform des dualen Systems – durch was begründet?
Der umfassende Zugang zur medizinischen Versorgung ist in Deutschland durch die allgemeine Krankenversicherungspflicht gewährleistet. Die Pandemie könne insoweit keinen Reformbedarf für das duale System – das Nebeneinander von PKV und GKV – begründen. Diejenigen, die die Krisenerfahrungen dazu nützen wollen, um eine Bürgerversicherung zu etablieren, könnten dies nicht damit begründen, dass einzelnen Personengruppen der Zugang zur Versorgung verwehrt geblieben sei, so Pimpertz.
Die Notwendigkeit zu einer grundsätzlichen Umgestaltung auf der Systemebene kann Pimpertz auch mit Blick auf die stationären Notfallkapazitäten in Deutschland nicht erkennen. In den Raum gestellt wird von Kritikern, dass es bei einem anderen Mix aus öffentlicher (48 Prozent Marktanteil) und freigemeinnütziger oder privater Trägerschaft (52 Prozent) möglicherweise besser gelungen wäre, zeitnah zusätzliche Intensivbetten-Kapazitäten bereitzustellen.
Stationäre Versorgung auf vielen Schultern – ein Vorteil
Das sieht Pimpertz anders: Dass sich die hohe Bettendichte – auch von Intensivbetten – auf eine nach Trägerschaft differenzierte Krankenhauslandschaft verteilt, habe sich möglicherweise günstig in der Pandemie ausgewirkt. Für eine höhere Leistungsfähigkeit öffentlicher Träger, die als Begründung für eine stärkere staatliche Steuerung herangezogen werden könnte, sieht er keine Belege.
Denn das Vorhalten von Notfallkapazitäten benötige zwingend weder eine öffentliche Bereitstellung noch eine Steuerfinanzierung. Angesichts der Versicherungspflicht in Deutschland ließen sich politisch gewünschte Versorgungskapazitäten auch durch private Akteure bereitstellen – entscheidend sei allein, ob die dafür nötigen Ressourcen im Gesundheitssystem auch refinanziert werden.
In der Konsequenz verbiete es sich, einfache Rückschlüsse zu ziehen von der Art der Trägerschaft auf die Leistungsfähigkeit der stationären Versorgung.
Ambulante Medizin als Bollwerk in der Pandemie
Auch mit Blick auf die ambulante Versorgung warnt der Gesundheitsökonom vor vorschnellen Schlussfolgerungen. So wird beispielsweise unter Ökonomen bislang die hierzulande hohe Konsultationshäufigkeit zwischen Ärzten und ihren Patienten als ein Indiz für mögliche „Effizienzreserven“ in der ambulanten Medizin angesehen.
Pimpertz hält es dagegen für plausibel, dass gerade die hohe Zahl an Arzt-Patienten-Kontakten – zusammen mit den neuen Möglichkeiten der Tele-AU – zu der bislang moderaten Entwicklung der Infektionszahlen und Todesfälle beigetragen haben kann.
Dazu verweist er auf Berichte aus Italien, wonach gerade die (zu) späte Konsultation von Hausärzten im Verlauf einer COVID-19-Erkrankung eine stationäre Einweisung der Betroffenen oft zwingend erforderlich machte. Demnach, so Pimpertz These, kam der privatwirtschaftlich organisierten, ambulanten Versorgung in Deutschland eine besondere Rolle bei der Krisenbewältigung zu.
Wissenschaftlich nachvollziebare Begründungen müssten folgen
In der Konsequenz hält der Gesundheitsökonom Skepsis für angebracht, wenn von den Herausforderungen durch die Pandemie auf einen systembezogenen Reformbedarf zugunsten einer stärker staatlichen Regulierung des Gesundheitswesens geschlossen wird.
Er fordert, angesichts der bisher vergleichsweise guten Performance des deutschen Gesundheitswesens müsse eine systembezogene Kritik am Status quo „wissenschaftlich nachvollziehbaren Begründungen folgen“.