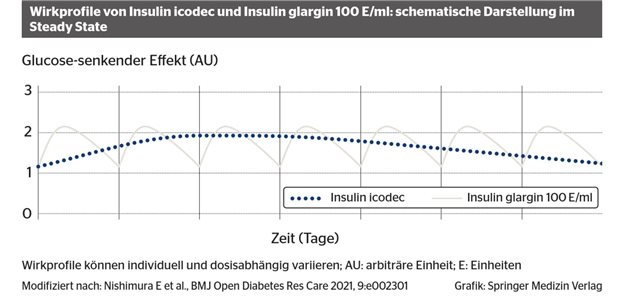Diabetes-Prävention
Politik muss mehr Gas geben
Ärzte und Krankenkassen fordern, dass bei Lebensmitteln der Zuckergehalt gekennzeichnet wird – und sie betonen: Um neue Diabeteserkrankungen zu vermeiden, ist mehr Prävention nötig.
Veröffentlicht:
Kuchen? Nein Danke! Diabetiker sollten zur Änderung ihres Lebensstils bereit sein.
© Pormezz / stock.adobe.com
Leipzig. Um neue Diabeteserkrankungen zu vermeiden, sollte der Zuckergehalt von Lebensmitteln klar und sofort erkennbar sein. Eine solche Kennzeichnungspflicht verlangte Rainer Striebel, Vorstandsvorsitzender der AOK Plus, auf der Tagung zu „innovativen Versorgungsstrukturen für Menschen mit Diabetes“.
„Ich wünsche mir von der Politik mehr Rückenwind, denn eine klare Kennzeichnung von Lebensmitteln ist unbedingt nötig“, sagte Striebel während der Tagung, die vom Deutschen Hausärzteverband und der Deutschen Diabetes Gesellschaft ausgerichtet wurde. „Es bleibt leider in den Ansätzen stecken, weil die Politik die Interessen aller berücksichtigen will.“
Mehr öffentlicher Druck nötig
Nach Striebels Ansicht ist mehr Ernsthaftigkeit in der Behandlung von Diabetes nötig. „Dazu gehört, dass der öffentliche Druck auf die Politik erhöht werden und sich die Versorgung konsequent an den Patienten und ihren Bedürfnissen orientieren muss.“
Diabetes stark unterschätzt
Erhard Siegel, Chefarzt des Diabeteszentrums am St. Josefskrankenhaus Heidelberg, sprach davon, dass Diabetes als Todesursache stark unterschätzt werde. „Stationäre Diabetologie ist nicht mehr finanzierbar“, schätzte der Privatdozent ein, der Vorsitzender des Berufsverbands der Diabetologen in Kliniken ist.
„Nur in 17 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland wird diabetologische Expertise vorgehalten.“ Es gebe „genügend Geld im Gesundheitssystem“, aber es müsse auch „für gute Versorgung von Diabetikern eingesetzt“ werden.
Jährlich 21 Milliarden Euro
Professor Monika Kellerer, Vorsitzende der Deutschen Diabetes Gesellschaft, nannte die Summe von 21 Milliarden Euro, die pro Jahr in der Bundesrepublik an Krankheitskosten wegen Diabetes ausgegeben würden. „Der Großteil des Geldes muss nicht für die Behandlung von Diabetes selbst, sondern für Folge- und Begleiterkrankungen aufgewandt werden“, fügte Kellerer hinzu.
Zu solchen Folgeerkrankungen zählen nach Einschätzung von Ingrid Dänschel vom Deutschen Hausärzteverband Depressionen bei Diabetikern. „Depressionen müssen mitbehandelt werden“, forderte sie.
Nähe der Schwerpunktpraxen wichtig
„Es nützt nichts, wenn Patienten zwar in Schwerpunktpraxen für Diabetologie gehen, aber ihre Medizin nicht einnehmen.“ Bernd Hagen vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland, berichtete davon, dass Schwerpunktpraxen eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Diabetes einnähmen.
So spiele die Entfernung zu Schwerpunktpraxen in ländlichen Regionen eine Rolle dabei, wie viele Amputationen etwa von Beinen als Folgeerkrankung von Diabetikern erforderlich seien. „Je besser Schwerpunktpraxen erreichbar sind, umso weniger Amputationen sind nötig.“
Prävention bisher vernachlässigt
Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, vermutet, dass „wir uns als Ärzte zu lange auf die Behandlung von Diabetes konzentriert und die Prävention vernachlässigt haben“.
Das bedeute auch, zu einem Patienten mit Diabetes zu sagen: „Du kannst nicht einfach wie bisher Dein Stück Schwarzwälder Kirschtorte essen und dann Insulin nehmen und denken, dass es damit getan ist“.
Bodendieck bemängelte, dass die „Eigenverantwortung bei vielen Patienten“ fehle. „Diabetiker müssen auch zu Änderungen ihres Lebensstils bereit sein“, fügte der 53-Jährige hinzu.